
Eine Zeit des Umbruchs und des Mangels
„Vor 100 Jahren: Murrhardt zu Beginn der Weimarer Republik“ Serie beleuchtet zentrale Themen des Jahres in der Walterichstadt
Wie war die Gesamtsituation der Walterichstadt vor 100 Jahren? Wie sah der Alltag ihrer Einwohner aus, und welche Ereignisse erregten deren Aufmerksamkeit? Diese Fragen sollen im Rahmen einer Serie, die morgen startet, beantwortet werden, die aus Ergebnissen vonRecherchen in den Akten des Stadtarchivs und des Jahrgangsbands 1919 der Murrhardter Zeitung zusammengestellt worden ist.
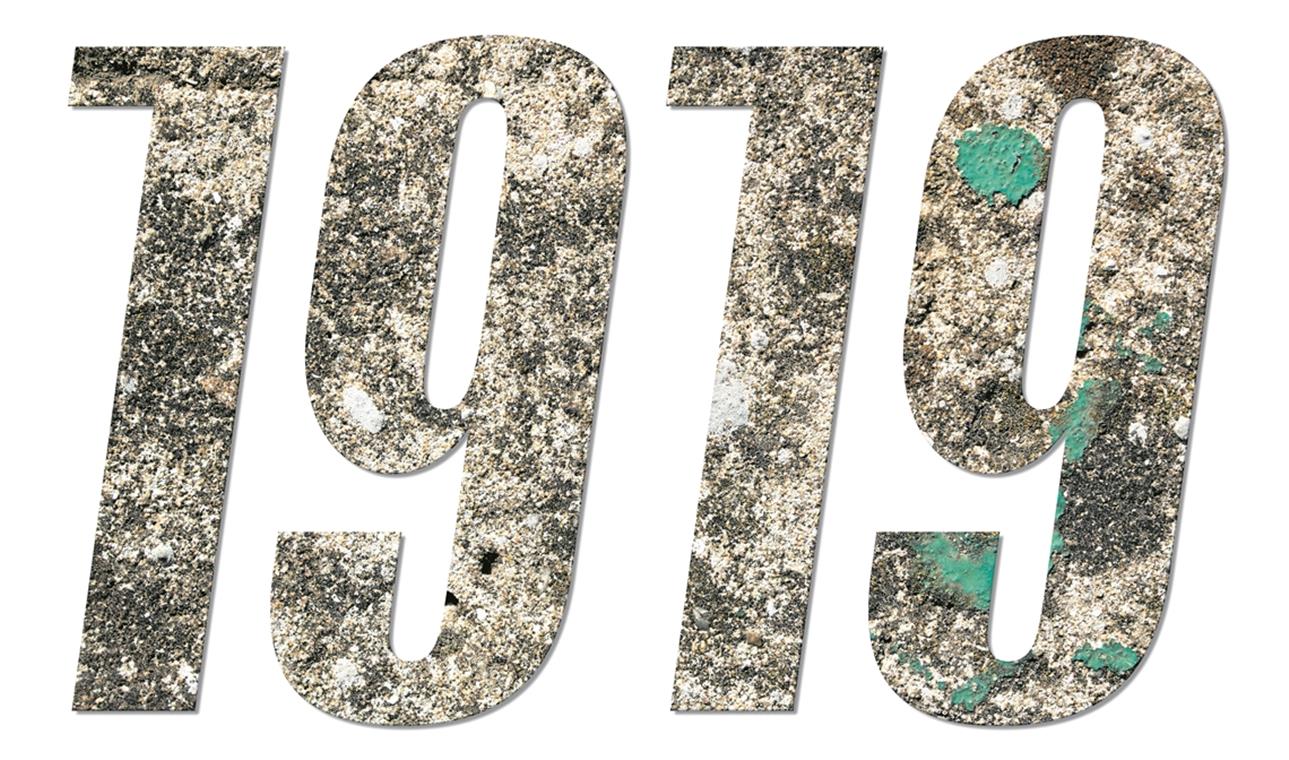
Im Fokus stehen wichtige Ereignisse im Jahr 1919. Foto: Adobe Stock/yadali
Von Elisabeth Klaper
MURRHARDT. Dabei gibt es auch einige interessante Parallelen zur heutigen Zeit zu entdecken. 1919 war das erste Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, in dem die Weimarer Republik begann. Namensgeberin ist die Stadt der berühmten Dichter-Klassiker, in deren Nationaltheater die Nationalversammlung die neue Verfassung ausarbeitete. Denn Berlin war zwar auch weiterhin Hauptstadt, doch wegen revolutionärer Unruhen zu unsicher. Die offizielle Bezeichnung des Staates blieb jedoch weiterhin „Deutsches Reich“. Und aus dem Königreich Württemberg wurde der republikanische „Volksstaat“. Auch für die Einwohner der Walterichstadt, die damals noch „Stadtgemeinde“ oder „Gesamtgemeinde“ hieß, war 1919 eine schwierige Zeit des Umbruchs und Wandels in der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Sie war verbunden mit einer Vielzahl von Problemen und großen Herausforderungen, wobei sich bedeutende außen- und innenpolitische Ereignisse auch direkt auf das Leben der Menschen im Oberen Murrtal auswirkten.
Im Rahmen der Serie werden verschiedene Schwerpunktthemen beleuchtet. So fanden 1919 drei wichtige Wahlen statt, erstmals nach demokratischen Spielregeln: am 12. Januar zur verfassungsgebenden württembergischen Landesversammlung, Vorläufer des heutigen Landtags, am 19. Januar zur verfassungsgebenden Nationalversammlung, und am 11. Mai wählten die Murrhardter einen neuen Gemeinderat. Wahlberechtigt waren alle Staatsbürger und Einwohner ab 20 Jahren, erstmals auch Frauen. Umgekehrt musste eine Person mindestens 25 Jahre alt sein, um gewählt werden zu können.
Eine große Belastung für die junge Republik mit schwerwiegenden Folgen und Auswirkungen auf die Politik, Gesellschaft und Wirtschaft stellte der am 28. Juni unterzeichnete Friedensvertrag von Versailles dar. Nichtsdestotrotz begann auch in der Walterichstadt allmählich wieder das gesellschaftliche Leben, zudem gab es eine Vielzahl wichtiger Vorhaben umzusetzen, wie Bauarbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur.
Während es in der Hauptstadt Berlin und in verschiedenen Ländern, Regionen und Großstädten vor allem in der ersten Jahreshälfte zahlreiche teils gewalttätige revolutionäre Aktivitäten, Aufstände und Umsturzversuche gab, blieb es im Oberen Murrtal weitgehend ruhig.
Allerdings gab es in der Walterichstadt auch eine größere Anzahl von Arbeitern, die teils Mitglieder der SPD und von Gewerkschaften waren und die Ende 1918 einen Arbeiterrat bildeten, hinzu kam Anfang 1919 auch ein Bauernrat. Welche Ziele diese Räte verfolgten und welche Aktivitäten sie dazu unternahmen, wird ebenfalls in einer Folge der Serie aufgezeigt.
Bereits vor Beginn des Ersten Weltkriegs begannen Aktivitäten und Verhandlungen zur Elektrizitätsversorgung Murrhardts – ein wichtiges Thema, zu dem im Stadtarchiv zahlreiche Akten vorhanden sind. Warum es dabei allerlei Schwierigkeiten gab und der Anschluss nicht wie geplant erfolgen konnte, wird zum Abschluss der Serie erläutert.
Aus den revolutionären Erschütterungen unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 ging das Deutsche Reich als parlamentarische Demokratie hervor. Während viele Deutsche mit dem politischen Neubeginn die Hoffnung auf Überwindung von Nationalismus und gesellschaftlichen Normen verbanden, verbitterten und radikalisierten die weiterhin bestehenden gravierenden Versorgungsprobleme und die große soziale Notlage Millionen von Menschen.
Demonstrationen und Streiks sowie politisch motivierte Unruhen prägten die schwierige Anfangsphase der Republik, die linke und rechte Extremisten bekämpften, indem sie gewaltsame Aufstände entfachten. Träger der politischen Macht waren die Parteien, indes hatten sie höchst unterschiedliche Vorstellungen über die politische Gestaltung Deutschlands. Uneingeschränkt zu den neuen demokratischen Verhältnissen bekannten sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), das Zentrum und die linksliberale Deutsche Demokratische Partei (DDP). Aber die republikfeindlichen Parteien auf der rechten und linken Seite des politischen Spektrums gewannen immer mehr Einfluss.
Quelle: Internetportal „Lebendiges Museum Online – Deutsches Historisches Museum“