
Wege des Denkens zu Gott
Kann man Gott beweisen?
Gott kann man erfahren. Doch lässt sich seine Existenz auch nachweisen? Theologen und Philosophen haben es immer wieder versucht.
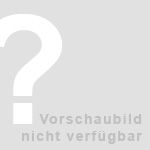
Die Erschaffung Adams: Deckenfresko des Renaissance-Malers Michelangelo Buonarroti in der Sixtinischen Kapelle.
Von Markus Brauer
Wer oder was ist Gott? Ist er erfahrbar? Und wenn wie und wo? Der Mensch steht grundsätzlich vor dem Problem eines verantwortlichen Sprechens von Gott, das sich zumal heute in der wissenschaftlich-technischen Welt im Lichte der Vernunft vollzieht.
Einladung zum Glauben
Deshalb ist das Denken genauso wie die Erfahrung ein zentraler Ort des Fragens nach Gott. Gottesbeweise sind der Versuch, mit Hilfe des Denkens das zu begründen, was man im Glauben bereits erfahren und als wahr erkannt hat. Die Dimension des sinnlich Wahrnehmbaren wird dabei ins Überweltliche, dem Metaphysischen, übertragen.
Gottesbeweise zwingen nicht zur Anerkenntnis ihrer Aussage. Sie sind vielmehr eine Einladung zum Glauben, ein begründeter Appell an die Freiheit und zugleich Ausdruck der Verantwortbarkeit des Glaubens vor der Vernunft. Sie geben Rechenschaft ab von der intellektuellen Redlichkeit des Glaubens.
Anselm von Canterbury
Der mittelalterliche Philosoph und Theologe Anselm von Canterbury (1033-1109) hat einen der bedeutendsten Gottesbeweise entwickelt. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass Gott das ist, was größer nicht gedacht werden kann. Der Glaube ist bei Anselm die notwendige Voraussetzung für die Einsicht des Denkens in die Existenz Gottes. Ein berühmter Satz von ihm lautet: „Credo, ut intelligam“ – Ich glaube, um zu verstehen.
Anselms Hauptwerk „Proslogion“, verfasst 1077/1078, gilt als erste Schrift, die Gott aus seinem Sein erschließt. Die darin entwickelte Begründung der Existenz Gottes wird auch ontologischer Gottesbeweis genannt (von griechisch „to on“, das Seiende, und „logos“, Wort, Lehre).
Die Argumentation lautet etwa so:
Thomas von Aquin
Thomas von Aquin (1225-1274) schließt von den Erscheinungen in der Welt auf Gottes Dasein.
René Descartes
Ein weiterer bedeutender Gottesbeweis stammt von René Descartes (1596-1650). Der französische Philosoph hat ihn in seiner Schrift „Meditationes prima philosophia“ dargelegt. Descartes geht davon aus, dass man nichts – auch nicht dem Denken – blind vertrauen darf. Er sucht nach einem Ausgangspunkt, der nicht mehr in Zweifel gezogen werden kann.
Fazit
Gottesbeweise wollen und können die Existenz Gottes nicht lückenlos und stichhaltig beweisen. Sie wollen vielmehr dazu einladen, über sich und die Welt genauer nachzudenken.