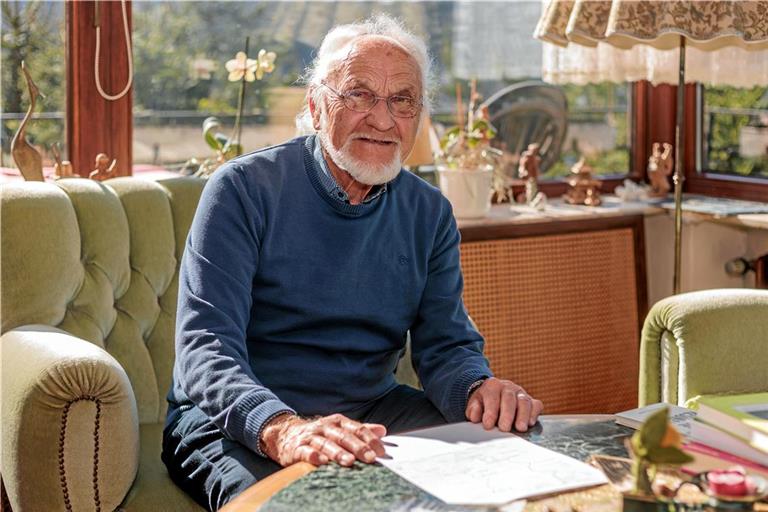Von der frühen weiblichen Dienstleistung
Der heutige Internationale Frauentag macht auf Rechte der Frauen aufmerksam und fordert Gleichberechtigung ein. Wie weit die Gesellschaft im 18/19. Jahrhundert noch davon entfernt war, zeigt ein Blick in die Geschichte und die Arbeit von Wirtinnen und Dienstmädchen.

© Jörg Fiedler
So hat die Murrhardter Malerin Trude Schüle (1929 bis 2016) die Sonne-Post als Aquarell festgehalten. Dort führte einst Mathilde Bofinger als Wirtin Regie. In Murrhardt gab es zwei weitere selbstbewusste Mathilden, die als frühe Dienstleisterinnen in Gasthäusern ihre Frau standen. Im Hintergrund auch vieler (groß-)bürgerlicher Haushalte wirbelte eine große Schar an Dienstmädchen, die alles am Laufen hielten. Archivfoto: J. Fiedler
Karin de la Roi-Frey
Murrhardt. Drei Murrhardter Mathilden, nämlich Gauss, Zügel und Bofinger, gingen als legendäre Wirtinnen in die Ortsgeschichte ein. Sie führten mit ihren Ehemännern nicht nur beliebte Speisegaststätten und Ausflugsziele, sondern auch Häuser wie die „Sonne-Post“, „eines der besten und gediegensten Häuser des ganzen Landes“, wie die „Murrhardter Wirtshausgeschichte(n)“ berichten, die Familie Schweizer zusammengetragen hat. Und „nebenbei“ sollen die drei Mathilden auch immer wieder sehr tatkräftig agiert und in der Ortspolitik mitgemischt haben. Mathilde Zügel, Wirtin des Engels, trat zudem bei den Römerfestspielen als Germanin hoch zu Pferde auf. Außerdem brachten die drei Kinder zur Welt, hatten eine Familie und als Wirtinnen stets gut auszuschauen, mussten sich um die Alten kümmern und noch so manche andere „typisch weibliche“ Aufgabe erfüllen.
Wie war das alles zu schaffen, in Zeiten teilweise noch ohne Lichtschalter, Wasserhähne, jederzeit abrufbare Wärme für die Stuben und Energie aus der Leitung zum Kochen? Für die Wirtinnen wie auch für die Eigentümer der Villa Frank mit ihren 42 Räumen und 1200 Quadratmetern Wohnfläche gab es nur ein Lösung: Dienstmädchen. Ob bei den Palms, Birkels und Daimlers in Schorndorf, den Nägeles und Karoline Schippert in Murrhardt oder den Fabrikanten Bauer und Munz in Welzheim – ohne Dienstmädchen ging gar nichts. Es war noch die Zeit, in der Häuser eines „gewissen Standards“ nicht ohne eine ganze Schar von Personal auskamen. Und so sorgten unterbezahlte und überarbeitete, eben aus der Schule entlassene Mädchen und ältere Frauen aus den umliegenden Dörfern, die sich gegen einen geringen Lohn „verdingt“ hatten, täglich 14 bis 18 Stunden an sieben Tagen in der Woche für das Wohlbefinden und die häusliche Behaglichkeit ihrer Herrschaft. Sie scheuerten Böden und Treppen, polierten das Silber, halfen bei den Waschtagen, putzten Schuhe, bürsteten und bügelten Kleidung auf, wischten Staub, wienerten Fenster und Spiegel auf Hochglanz, bügelten bis in die Nacht hinein, schleppten Feuerholz und waren morgens nach wenigen Stunden Schlaf als Erste in der noch kalten Küche, um das noch glimmende Feuer wieder zu entfachen, den Kaffee des Hausherrn aufzusetzen und ihn dann gleich nach dem Aufziehen der schweren Vorhänge im Schlafzimmer ihres Arbeitgebers zu servieren.
Erst sexuelles Freiwild, dann wegen einer Schwangerschaft entlassen
Und nicht jedes Dienstmädchen kam ohne anzügliche Bemerkungen oder gar handfeste Belästigung wieder aus dem Zimmer. „Dass die Herren der normalen wilhelminischen Bürgerhäuser in der Anstellung, die ein Dienstmädchen bei ihnen nahm, eine Art sexuellen Verfügungsrechts enthalten sahen, ...sind oft betonte und gesicherte Tatbestände“, heißt es in einer historischen Abhandlung über Dienstmädchen. So schwängerte der Dichter Leo Tolstoi als junger Mann ein Dienstmädchen seiner Familie, das daraufhin das Gut verlassen musste. Ähnlich erging es zu Beginn des 18. Jahrhunderts einer jungen Frau aus Rommelshausen im Remstal. „Die Vorsehung hat dich in einen Stand geboren werden lassen, wo du andern Menschen dienen musst“, lautete die gängige Ansicht. Und so wurde sie zweimal schwanger als Dienstmädchen in der Mühle von Kirchberg an der Murr. Sie verlor ihre Stellung und wanderte schließlich nach Amerika aus. Vom Vater findet sich in den Kirchenbüchern kein Wort. Wie hieß es doch? „Hätt’s halt aufpasst, das Luder!“ Ruhezeiten waren für Dienstmädchen nicht vorgesehen, ständige Arbeitsbereitschaft selbstverständlich. Ein Nachtquartier gab’s im Stall oder im Verschlag unter der Treppe. Die Familie durften Dienstmädchen an dem einen freien Tag im Monat besuchen, wenn die Zeit für den Hin- und Rückweg zu Fuß denn reichte.
Dem ehemaligen Rudersberger Dienstmädchen Christiane Pregizer (1798 bis 1867) machte es nichts aus, in einem sogenannten Hängeboden unter der Raumdecke zu schlafen und in einer kellerlochartigen Küche zu arbeiten. Es gab auch kein Gehalt, Essen und Kleidung waren der einzige Lohn, aber die gläubige Pietistin war angekommen in St. Chrischona bei Basel. Die „Stunde“, die abendlichen Zusammenkünfte mit den anderen Glaubensschwestern und -brüdern, hatte über Jahrzehnte Kraft gegeben, das harte Leben als Dienstmagd durchzustehen. Nun war Christiane Pregizer in einer Gemeinschaft aufgenommen, in der sie geachtet wurde und eigenverantwortlich arbeitete. Wo war es ihr besser ergangen?
In den „Osterbriefen für die Frau“ prangerte die einflussreiche Schriftstellerin Fanny Lewald (1811 bis 1889) 1863 die Lage der Dienstmädchen an. Ihr Arbeitstag hatte 16 Stunden. In Erinnerungen heißt es: „Mein Bett war immer voller Mäusedreck“, „Ich hatte immer Hunger“ und „Der Sohn im Haus dachte, dass ein Mädchen Freiwild ist“. Ostern, das kirchliche Fest der Auferstehung, deutete Fanny Lewald weltlich und forderte die Frauen auf, sich Bildung und Ausbildung anzueignen. Nur so könnten sie der endlosen Tretmühle des Dienstmädchendaseins entrinnen und sich ein selbstbestimmtes Leben aufbauen. Glückliches Dienstmädchen, das sich aus der Bibliothek des Hausherrn Bücher entleihen durfte, auch informative Zeitschriften standen ihr zur Verfügung. Kolleginnen kauften sich die „Groschenhefte“ und dazu meinte sie: „Bei solcher Lektüre muss man ja ,beschränkt‘ bleiben. Das war auch so erwünscht.“
„Damals herrschte die ,Dienstbotenkultur‘; in allen Schichten der Bourgeoisie lebte man nur dank des unterbezahlten, manchmal gar nicht bezahlten ,Personals‘“, schreibt der Urenkel einer Frauenrechtlerin, und man war sich darüber einig, dass die Gemütlichkeit und der Friede des Familienlebens zum großen Teil von einer glücklichen Lösung der Dienstbotenfrage abhängig war. Über Jahrzehnte arbeiteten manche Dienstmädchen, die egal welchen Alters immer „Mädchen“ blieben, bei der gleichen Familie. Manchen wurde ausdrücklich gedankt. So verschenkte Herzogin Anna Amalia von Weimar ihre Schuhe, die sie nur einmal trug. Der Philosoph Arthur Schopenhauer bedachte seine Wirtschafterin im Testament. Paul Gauguin verschenkte eines seiner Gemälde, das allerdings wegen der noch erfolglosen Arbeit des Malers weggeworfen wurde. Glücklich, wer im Alter ein Zimmer und damit zum ersten Mal im Leben einen eigenen Raum in einem Altersruhesitz, der „Dienstbotenheimat“, beziehen konnte, wenn auch dort so strenge Regeln herrschten, dass sich manche wie im „Zuchthaus“ gefühlt haben soll. Ein allerletzter Dank an die helfende Hand im Haushalt findet sich manchmal auch noch auf Friedhöfen: „Hier ruht meine langjährige treu sorgende Haushälterin“.