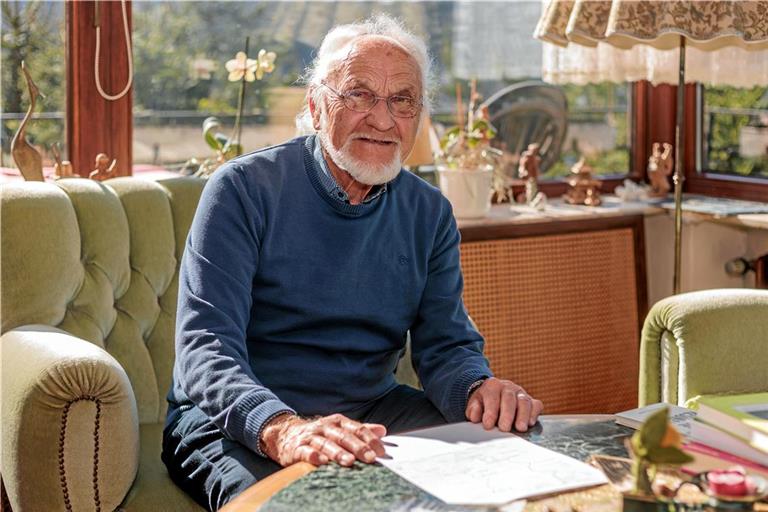Aufarbeitung gestaltete sich schwierig
Vor 75 Jahren: Erinnerungen an die Nachkriegszeit in Murrhardt (5) Die Entnazifizierungsverfahren erfassten die Belastung und wollten politisch gefährliche Menschen ausmachen. Beispiele zeigen, dass die persönliche Auseinandersetzung aber schwerfiel.

Von Elisabeth Klaper
MURRHARDT. Schon bald nach Kriegsende begann die US-Militärregierung damit, NSDAP-Mitglieder und Personen, die während der NS-Diktatur öffentliche Ämter innehatten und wichtige Aufgaben wahrnahmen, aus ihren Stellungen und Institutionen der Gesellschaft zu entfernen. Auch zahlreiche Einwohner der Walterichstadt mussten sich Entnazifizierungsverfahren vor Spruchkammern stellen, die mit fachkundigen Personen aus Backnang und Murrhardt besetzt waren. Dies geht aus Zeitzeugenberichten und Ergebnissen der historischen Forschungen hervor.
Laut Zeitzeuge Wilhelm Wieland waren nicht wenige Handwerker und Bauern, Akademiker und Beamte, Geschäftsleute und Unternehmer der Walterichstadt Anhänger des NS-Regimes, oft aber auch nur Parteimitglieder, weil es für sie beruflich von Vorteil war. Für sie standen „die materiellen und finanziellen Eigeninteressen weit über dem Gemeinwohl“. Zudem sei das Hamstern und Horten von Lebensmitteln und Waren aller Art durch örtliche Geschäftsleute bereits während des Krieges gang und gäbe gewesen und habe die Versorgungskrise in der Nachkriegszeit verstärkt, so Wieland.
1946 veröffentlichten die Alliierten Richtlinien, wie aktive Nationalsozialisten, Helfer und Nutznießer des NS-Regimes behandelt werden sollten. Zur „gerechten Beurteilung der Verantwortlichkeit“ und zur „Heranziehung zu Sühnemaßnahmen“ teilte man die Betroffenen in fünf Gruppen ein: 1. Hauptschuldige, 2. Belastete, dazu gehörten Aktivisten, Militaristen und Nutznießer, 3. Minderbelastete, 4. Mitläufer und 5. Entlastete, das waren Personen, die vor einer Spruchkammer nachweisen konnten, dass sie nicht schuldig waren.
Personen der ersten vier Gruppen verurteilten die Spruchkammern zu Geldstrafen, gemeinnützigen Arbeitseinsätzen und auch Haft. Als die Amerikaner die Entnazifizierung am 31. März 1948 einstellten, waren jedoch etliche Verfahren gegen schwer Belastete noch nicht abgeschlossen, weshalb viele Schuldige einer Bestrafung entgingen. Entsprechend dem Grundsatz der Reeducation gestalteten die Alliierten in einem umfassenden Umerziehungsprogramm die Bildung, Kultur und Medien in Deutschland neu.
Laut Heimatgeschichtsforscher Christian Schweizer sind fast alle Akten über Spruchkammerverfahren erhalten, denen sich Murrhardter Bürger stellen mussten, und in den Staatsarchiven Stuttgart oder Ludwigsburg zugänglich. „Diese Verfahren liefen mit den damaligen Möglichkeiten und dem damaligen Wissensstand ab. Kurz nach Kriegsende bestand für die Betroffenen jedoch das große Problem, Entlastungszeugen zu bekommen, da oft nicht bekannt war, wo diese Zeugen sich aufhielten.“ Die Amerikaner „hatten kein großes Interesse daran, regionale NS-Größen zu enttarnen oder zu belasten“.
Entnazifizierungsverfahren bei besonderen Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Justiz habe man schnell abgeschlossen. Denn wegen des großen Mangels an erfahrenen Fachkräften für den Wiederaufbau waren die Fachkenntnisse und Erfahrungen vieler Führungskräfte aller Art dringend erforderlich, darum seien viele dieser Personen rasch wieder rehabilitiert worden, verdeutlicht Schweizer. Als Beispiel nennt der Heimatgeschichtsforscher den Fabrikanten Erich Schumm, der den kriegswichtigen Trockenbrennstoff Esbit herstellte. Zudem benötigte man im beginnenden Kalten Krieg viele derartige Produkte wieder.
„In Murrhardt wurden kurz nach Kriegsende zahlreiche Bürger“, die Mitglied in der NSDAP und diversen NS-Organisationen waren, als Sühneleistung und Bestrafung „zur Zwangsarbeit im Wald, beim Straßen- und Wegebau sowie zu anderen Aufgaben herangezogen“, erzählt Schweizer. „Darunter befanden sich auch Personen, die zwar Parteimitglieder waren, aber eigentlich Widerstandskämpfer, wie Rudolf Hartmann, auch gelang es manchen, sich dem Zugriff zu entziehen.“
Bei einem Gedenktag 1946 für die Opfer des Nationalsozialismus fanden sich nur wenige ein.
Diese Arbeitseinsätze erwähnt auch Eugen Gürr in seiner „Murrhardter Chronik 1945/46“. Anfang Oktober 1945 berichtet er, dass ehemalige NSDAP-Mitglieder aus allen wichtigen Positionen in Verwaltung, Industrie, Handels- und Gewerbebetrieben im Kreis Backnang entlassen wurden, und einige davon betroffene Murrhardter machten im Dienst der Allgemeinheit Holz im Wald. Doch kam die Entnazifizierung erst ab Frühjahr 1946 richtig in Gang. „Die Entnazifizierung macht offenbar langsam vorwärts, man erfährt die Tatsachen wenig, aber man sieht manchen laufen, um sich die Belege zu beschaffen, die er deutsch und englisch vorlegen will. (...) Auch bei den Lehrern fängt jetzt ein Revisionsverfahren an zu arbeiten“, schreibt Gürr.
Am 23. September 1946 fand ein Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus statt: „...In der Kirche verlas Stadtpfarrer Gotthilf Leitz zuerst einen Gedenkbrief des Landesbischofs Wurm. Dieser erinnert an alle Opfer des Kriegs draußen und daheim an Menschenleben, Schäden an Besitz und sittlichen Werten, durch Faschismus bis zu den getöteten Kranken und Bresthaften (nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung für kranke, gebrechliche und behinderte Menschen), für die das 3. Reich keinen Unterhalt hatte. (...) Um 11 Uhr war die Kundgebung im Stadtgarten. Arg wenig waren da. Eine alte Frau oben am Kirchrain sagte: ,D’Leut wöllet halt nix meh wisse.‘“
Laut Gürr waren ein paar Einwohner von den Teilorten und auch Ostflüchtlinge anwesend. „Der Liederkranz und die Kapelle Karl Rößler boten vorher und nachher ernste Stücke. Gewerkschafts- und KPD-Mitglied Karl Sinn sprach in ernster, würdiger Form über die heute noch unfassbar großen Verluste (...), über die bösen, uns in der Welt herabsetzenden, scheußlichen Taten des Faschismus.“ Anfang November war „ein Aufruf am Rathaus angeschlagen vom Ministerium für politische Säuberung: Die Bevölkerung muss mithelfen, dass auch die versteckten Nationalsozialisten und Parteigenossen zur Sühne herangezogen werden.“
Der Murrhardter Historiker Professor Gerhard Fritz, Herausgeber der „Murrhardter Chronik 1945/46“ von Eugen Gürr, schreibt in seinem Kommentar: „Was man weitgehend vermisst, ist die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit.“ Laut Fritz wurden die Nazis natürlich nicht im Nachhinein entschuldigt. Indes verdeutliche die Chronik, dass man ohne die vielen kleinen politischen Mitläufer des NS-Regimes gar nicht auskommen konnte. Insofern dachte niemand daran, diese moralisch und materiell zu denunzieren und zu diskriminieren. Da die Murrhardter Nazis in Gürrs Chronik namentlich fast nie genannt werden, vermutet der Historiker, dass sie nicht bloßgestellt werden sollten. Diese Haltung zeige, wie man mit der NS-Zeit umgehen wollte: Einen Schlussstrich ziehen, soweit das möglich war. „Zwar löste ein von der US-Besatzungsmacht am 29. Juli 1945 gezeigter Film über das KZ Dachau einen Schock aus – aber zu einer (...) Reflexion Gürrs über die NS-Verbrechen kam es nicht“: Die Hektik der Nachkriegsereignisse, die alltäglichen Sorgen um die Lebensmittelversorgung, einquartierten Flüchtlinge, noch nicht zurückgekehrten Kriegsgefangenen und den Wiederaufbau machten eine derartige Aufarbeitung offenbar unmöglich.
„Die Auseinandersetzung Gürrs und seiner Zeitgenossen (mit der NS-Diktatur) beschränkte sich offenbar praktisch ausschließlich auf die formale Entnazifizierung vor den Spruchkammern. Diese 1946 anlaufenden Verfahren wurden aber (...) als eine eher bürokratische Abrechnung erfahren. Man erwartete von ihr nichts Gutes, hatte Angst, auch wenn man sich gar nichts oder kaum etwas vorzuwerfen hatte – man wusste nicht, was da auf einen zukam. Denn es gab ja fast keinen, der nicht irgendwie verstrickt war.“
Leider erwähnt Gürr laut Fritz „nichts über die Praxis der ,Persilscheine‘, mit denen sich selbst gestandene Nazis reinzuwaschen verstanden (...), Anpassungsfähige und schwerer belastete Typen (...) kamen (...) unbeschadet durch die Klippen der Entnazifizierung, die sich auch in Murrhardt als wenig wirksam, aber dafür umso bürokratischer erwies. Bemerkenswert ist auch, dass der sozialdemokratische Bürgermeister Georg Krißler sich um die Freilassung einzelner inhaftierter Murrhardter Nazis bemühte.“
Ziel der Entnazifizierung sei es gewesen, Personen, die man aufgrund ihrer Vergangenheit im Nationalsozialismus als „belastet“ betrachtete, zeitweilig von verantwortlichen Stellen im öffentlichen Leben zu entfernen, verdeutlicht die Zeithistorikerin und Entnazifizierungsexpertin Hanne Leßau. Solche Personen galten als potenzielles Sicherheitsrisiko beim Aufbau des demokratischen Nachkriegsdeutschlands, erläutert sie im Vortrag „Die Praxis der Entnazifizierung. Zur politischen ,Säuberung‘ der deutschen Gesellschaft nach 1945“.
Die Entnazifizierung begann mit dem Ausfüllen eines Fragebogens, wobei die darin gemachten Angaben eine entscheidende Rolle für den Verlauf und Ausgang des Prüfverfahrens spielten. Sie waren Grundlage der Prüfung durch die Entnazifizierungsstellen. Mit Fragen zur Berufsbiografie und zur Stellung des Einzelnen im Institutionengefüge des Nationalsozialismus überprüfte man die Betroffenen. Das Dokument fragte nach Mitgliedschaften, Ämtern, Mitarbeit in der Partei und NS-Organisationen sowie nach dem beruflichen Werdegang.
So galt es zu klären, ob der Überprüfte in seinem Beruf oder in politischen Ämtern zum Funktionieren der NS-Diktatur beigetragen oder von ihr profitiert hatte. Aber: „Fragen, die auf den Kenntnisstand von Verbrechen abzielten, sucht man in den verschiedenen Versionen des Fragebogens ebenso vergeblich wie Fragen, die Auskunft darüber verlangten, ob man an alltäglichen Verfolgungs- und Ausgrenzungspraktiken Anteil gehabt hatte“, stellt Leßau klar. Die Verfahren konfrontierten die zu Überprüfenden mit deren eigener, individueller Vergangenheit im Nationalsozialismus.
„Das Ausfüllen des Fragebogens war schwierig, denn oft fehlten erfragte Informationen, die in einem von Mangel und Zerstörung bestimmten Umfeld oft aufwendig recherchiert werden mussten.“ Viele Betroffene verfassten zudem Begleitschreiben mit biografischen Skizzen über ihr Leben im Nationalsozialismus, eingebettet in Lebensläufe oder umfangreiche Schilderungen ihres beruflichen oder sozialen Werdegangs. So versuchten sie, die Kategorien und Anforderungen der Entnazifizierung mit der eigenen Vergangenheit in Einklang zu bringen, fasst die Historikerin ihre Forschungsergebnisse zusammen.