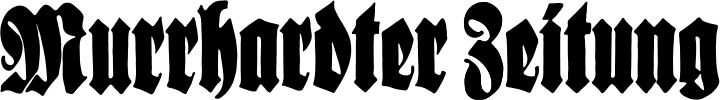Frankreichs Afrikapolitik
Das Erbe des Kolonialismus
das Enthüllungsbuch eines Insiders zeigt die neokoloniale Tradition der Pariser Politik. Sie wirkt bis heute fort.

©
Tief im afrikanischen Korruptionssumpf: Jacques Chirac.
Von Christian Putsch
Die Lieferung des Geldes erfolgte in Djembé-Trommeln, bespannt mit Ziegenfell. Ein Repräsentant des damaligen Präsidenten Burkina Fasos, Blaise Compaoré, hatte im Jahr 2002 um ein Treffen mit Jacques Chirac gebeten, der damals in Frankreich im Wahlkampf war. Die Trommeln wurden aufgeschnitten, heraus fielen unzählige Geldscheine. „Typisch Blaise”, schmunzelte Chirac angeblich, „er hat uns kleine Banknoten geschickt.”
So hat es sich zumindest gemäß den gerade veröffentlichten Memoiren von Robert Bourgi zugetragen. Jahrzehntelang hatte der im Senegal geborene, libanesisch-französische Anwalt die Verstrickungen zwischen Frankreich und den ehemaligen westafrikanischen Kolonien mitorganisiert. Geldgeschenke auf beiden Seiten, etwa zur Finanzierung von Wahlkämpfen, waren Alltag. Bei den Präsidentschaftswahlen 1995 und 2002, die beide von Chirac gewonnen wurden, seien jeweils rund 10 Millionen Dollar von afrikanischen Präsidenten gezahlt worden, behauptet Bourgi. Im Gegenzug habe man auf Frankreichs Nachsicht bei Demokratiedefiziten in Ländern wie Gabun oder Kongo-Brazzaville (dem kleineren Kongo) zählen können.
„Frankreichs Fehler ist die Arroganz“
Der 2019 verstorbene Chirac stritt all das zeitlebens ab, entsprechende Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt. In seinem Buch liefert Bourgi nun Details zur sogenannten Françafrique, also der französischen Afrikapolitik. Deren Ende hat Emmanuel Macron im Jahr 2017 versprochen. Dennoch wurde der Vorwurf des Neokolonialismus bei Umstürzen wie im Niger oder in Burkina Faso als Kampfbegriff gegen die jeweiligen Amtsinhaber benutzt – oft als Vorwand, manchmal aber mit einem Funken Wahrheit. „Afrika hat sich globalisiert”, schreibt Bourgi. Und Frankreich mache den immer gleichen Fehler: Arroganz.