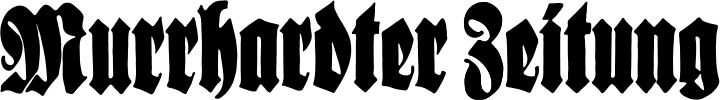EM 2024
Das neue Spanien – wie sich die Furia Roja weiterentwickelt hat
Mit dem Titelgewinn tritt in Spanien endgültig die nächste Generation in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Vorgänger – von denen sie sich merklich abhebt.

© imago//Christian Kolbert
Spanien ist zurück auf Europas Fußball-Thron.
Von David Scheu
Alte und neue Helden, frühere Titelsammler und heutige Thronfolger – beide führte die spanische Fußballnacht von Berlin zusammen, beide erlebten bleibende Szenen im Olympiastadion. Während die Spieler der Furia Roja auf dem Rasen ihren Emotionen nach dem 2:1 im EM-Finale gegen England freien Lauf ließen, applaudierten auf der Tribüne die einstigen Leitwölfe Xavi und Andres Iniesta anhaltend.
2012 hatten sie Spanien bei der EM zum bislang letzten großen Titel geführt, nun wohnten sie der Stabübergabe aus nächster Nähe bei. Nur: Dieses Mal waren Dinge passiert, die vor zwölf Jahren unvorstellbar waren. Die entscheidenden Protagonisten im Hier und Jetzt kommen längst nicht mehr nur von den beiden Schwergewichten Real Madrid und FC Barcelona. Das Spanien im Jahr 2024 hat ein anderes Gesicht.
Dass sich die außerordentliche Breite des Siegerkaders auch in der Zahl der vertretenen Vereine spiegelt, war selten deutlicher zu beobachten als im Endspiel und seinen vereinzelten kritischen Phasen. Zur Halbzeit zum Beispiel, als Mittelfeldchef Rodri nach einem geblockten Schuss verletzt vom Feld musste. Was nach einem mittelgroßen Problem aussah, war schnell kein Thema mehr – dank eines jungen Manns von Real Sociedad San Sebastian. Martin Zubimendi ersetzte den Taktgeber im Zentrum, als sei es das Einfachste der Welt. Er fügte sich ein, verteilte die Bälle, erhielt im Anschluss gar ein Sonderlob von Luis de la Fuente. Eine „sensationelle zweite Hälfte“ attestierte der Trainer seinem Einwechselspieler.
Viele Europameister aus San Sebastian
Zubimendi war nicht der einzige Profi vom Tabellensechsten der spanischen Liga, der im Finale zum Faktor wurde: Als alles auf eine Verlängerung hindeutete nach der spanischen Führung durch Nico Williams (47.) und dem englischen Ausgleich durch Cole Palmer (73.), grätschte Mikel Oyarzabal eine Flanke mit einem großen Spreizschritt ins Tor (86.). Der Rest war riesiger Jubel – nicht zuletzt in San Sebastian, wo Oyarzabal seit Jahren sein Geld verdient. Immerhin fünf Profis im Kader des neuen Europameisters stellte der Club aus dem äußersten Norden Spaniens, auch Mikel Merino zählt dazu, der Siegtorschütze im Viertelfinale gegen Deutschland.
Dieser Aspekt ist auch deshalb aufschlussreich, weil er ein Licht wirft auf die fußballerische Sozialisation vieler Europameister. San Sebastian hat sich einen Namen gemacht mit nachhaltiger Nachwuchsarbeit, die Talenten unüblich viel Zeit zum Reifen gibt. Zubimendi debütierte erst mit 20 Jahren als Profi, war damals noch längst kein Stammspieler. Heute gilt er im Club als unersetzlich, Barcelona hatte ihm im Vorjahr als Nachfolger für Sergio Busquets im Blick. Er lehnte dankend ab – lange Verweildauern sind ein Markenzeichen beim baskischen Verein. Zubimendi spielt schon sein Leben lang in San Sebastian, Oyarzabal seit der Jugend, Merino seit sechs Jahren. Alle entwickelten sie sich in einem ruhigen Umfeld, dieser Karriereweg ist mindestens so sehr Teil des spanischen Gesamtbilds wie jener der jungen Shootingstars Nico Williams (22) und Lamine Yamal (17).
Flut an Bestmarken für das spanische Team
Das wiederum hängt untrennbar mit dem Trainer zusammen. Luis de la Fuente hat keine klassische Karriere im Vereinsfußball hinter sich; er leitete jahrelang die spanischen Nachwuchs-Nationalmannschaften an, wurde mit vielen seiner heutigen Spieler einst Europameister mit der U 19 und der U 21. Man kennt sich, die Türen standen und stehen offen, der jüngste Titel war die Fortführung eines längeren gemeinsamen Weges. „Ich bin sehr privilegiert“, sagt de la Fuente, „eine solch tolle Generation an Spielern trainieren zu dürfen.“
Der Sieg gegen England markiert deshalb mehr als das bloße Ende einer zwölfjährigen titellosen Zeit. In Berlin hat endgültig eine neue spanische Generation übernommen, die sich auch durch ihr Auftreten von den berühmten Vorgängern abhebt: De la Fuente hat einen neuen Stil implementiert, das Tiki-Taka mit einem reinen Ballbesitzfokus gehört der Vergangenheit an. „Wir haben versucht, in der Offensive etwas unvorhersehbarer und dynamischer zu agieren“, sagt der 63-Jährige.
Der hat zu einer wahren Flut an Bestmarken geführt. Nie zuvor erzielte ein Team 15 Tore bei einer EM, nie zuvor wurden sämtliche sieben Turnierspiele gewonnen – sofern man den Erfolg über Deutschland im Viertelfinale in der Verlängerung nicht als Remis wertet. Persönliche Auszeichnungen kamen wenig überraschend dazu: für Lamine Yamal als besten Jungprofi, für Rodri als besten Spieler. Dieser sei für ihn sowieso Kandidat Nummer eins für den Titel des Weltfußballers, betonte de la Fuente, der spät am Abend auf der Pressekonferenz nach Wochen selbstbewusster Sachlichkeit förmlich auftaute: Er winkte in die Menge, stand für Fotos bereit, lächelte, scherzte. Der Titelgewinn wirkte unverkennbar als Brustlöser, womöglich schon für kommende Aufgaben.
Das Ziel liegt dabei auf der Hand: Es gibt noch viel zu erreichen und zu bestätigen, die letzte goldene Generation wurde zwischen 2008 und 2012 zweimal Europa- und einmal Weltmeister. „Jetzt sind wir für die nächste Herausforderung bereit“, sagte Williams, was ein wenig schon nach einer Kampfansage an die Konkurrenz klang. Die Titelgier der spanischen Thronfolger ist noch lange nicht gestillt.