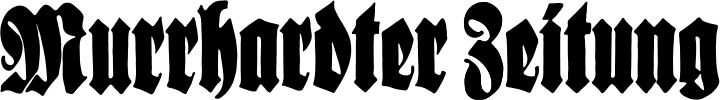Ort in Russland
Ein Dorf namens Diktatura
Die Sowjetunion hat in Diktatura allerlei Ruinen hinterlassen. Dem Dorf, so unscheinbar, wie es so viele Dörfer quer durch Russland gibt. Weg war die Diktatur hier nie. Der Krieg in der Ukraine – seit drei Jahren nun – hat die Mechanismen nur noch verstärkt.

© Inna Hartwich
Diktatura: Ein Ort, wie es ihn so viele gibt quer durch Russland. Ein paar hundert Seelen, viel Land, viel Wald, viel Wiese.
Von Inna Hartwich
Sie hat selten etwas anderes gesehen in ihrem Leben. Das Dorf, das war ihr Ding. Die Kinder, die Arbeit in der Bibliothek. Immer nur Diktatura. Ein Ort, wie es ihn so viele gibt quer durch Russland. Ein paar hundert Seelen, viel Land, viel Wald, viel Wiese. Die Straßen heißen Sowjetische, Straße der Arbeit, Straße der Jugend, ein Spielplatz mit Schaukel und Rutsche, eine Erste-Hilfe-Station. Das Werk nennt sich „Bestarbeiter“, wie einst die sowjetische Sowchose.
Tatjana Grischina kennt jede Ecke von Diktatura, sie war hier aufgewachsen und ist nie weggegangen. „Einmal Moskau und zweimal Kiew, noch zu Sowjetzeiten. Für andere Abenteuer hat das Geld gefehlt. Und auch der Wille. Ich bin eine Diktatur-Seele“, sagt die 68-Jährige und lächelt verschmitzt. Mancher zweistöckige Plattenbau, einst der Stolz des Ortes, ist ein Geisterhaus, die Fenster sind ausgeschlagen, im Hof liegt verrostetes Metall.
Diktatura ist ein Sackgassendorf. Moskau ist knapp 300 Kilometer nördlich. Knapp 400 Kilometer südwestlich liegt die Front. Drei Jahre Leid, Zerstörung, Verheerungen, die Russlands Präsident Wladimir Putin seit seinem Marschbefehl am 24. Februar 2022 nicht nur über die Ukraine, sondern auch über sein eigenes Land gebracht hat. „Saschka, Wowan, Artur, Serjoschka, Mischka, Aljoscha“, Grischina zählt die Namen derer aus dem Dorf auf, die in den Krieg gezogen waren. Fast alle freiwillig. Einer ist verschollen, ein anderer tot. „Sie sind Patrioten, sie erfüllen ihre Pflicht“, sagt die Rentnerin und stapft weiter durch den Schnee, vorbei an verfallenen Holzhäuschen zur Essensaufbewahrung, den Mülltonnen mit einem aufgemalten Z, dem Zeichen der Unterstützung des Krieges, den brachliegenden Garagen. An einen Trümmerhaufen im Feld hat jemand „Pustota“ hingepinselt. Leere.
Gewalt ist Staatsräson. Die Menschen tragen sie mit.
Es ist ein Wort, das den Zustand der Menschen im Land ganz gut beschreibt. Äußerlich wie innerlich. Als würde das Schweigen sich im ganzen Land wie ein Sumpf ausbreiten und alles Lebendige, wenn es denn jemals da war, verschlingen. Hineinziehen in den Morast aus Verwerfungen und Beschönigungen. Bloß nicht nachdenken! Nichts wissen wollen! Nichts fühlen! Nicht über Dinge sprechen, die Schmerzen verursachen, die Zweifel hervorrufen! Lieber verstecken in der Scheinwelt, in der jemand in verächtlichstem Schwarz-Weiß die Dinge seit Jahrzehnten stumpf wiederholt, bis sie scheinbar zur Realität werden. Eine Realität voller Angst und Ungewissheit.
Irgendwo in der Tiefe aber modert es weiter. Wie es all die Jahrzehnte zuvor gemodert hat, weil niemand aus der Führungsspitze die Verantwortung für die Verbrechen übernimmt, die der eigene Staat seinen Menschen antat und antut. Gewalt ist Staatsräson. Die Menschen tragen sie mit.
„Wir haben fast alle Verwandte in der Ukraine“, erzählt Grischina. Ihr Bruder war zu Sowjetzeiten nach Kiew gezogen. „Seine Familie spricht nicht mehr mit mir. Ich verstehe nicht warum. Wir haben ihnen doch nichts getan“, sagt sie. Für sie ist das Thema damit erledigt. „Ach, Chochly“, schimpft die Witwe immer wieder und gebraucht diese abwertende Bezeichnung, die Russlands Propagandisten und Nationalisten für Ukrainer benutzen. „Sie sind doch eh unser russisches Volk“, sagt sie.
Tatjana Grischina wiederholt die Sätze, die sie Tag für Tag im Fernsehen hört. Sie stellt sie gar nicht in Frage. Wie auch, wenn sie ihr Leben lang gelernt hat, nichts in Frage zu stellen?„Kluge Leute machen sich Gedanken über das Leben. Kluge Leute haben auch mehr Kopfweh als ich.“
Grischina geht fast täglich die Wege durch den Ort, in der Bibliothek hat sie noch eine Viertelstelle, das gibt zu ihrer Rente von umgerechnet 150 Euro noch 80 Euro dazu. Seit 50 Jahren arbeitet sie dort, sortiert Bücher, schreibt handschriftlich über die Ereignisse im Dorf. Ein neues Denkmal für die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg, ein Besucher aus Frankreich, weil dessen Vorfahr noch aus dem zaristischen Russland geflüchtet war, Neujahrsfeiern, Leseabende. „Ach, da waren wir alle noch so jung. Schön waren die Zeiten in der Sowjetunion“, sagt sie.
Auch ihre jüngeren Bekannten Inessa und Swetlana, die sie im Kontor des Dorf-Unternehmens antrifft, betonen immer wieder „die schöne Sowjetzeit“. Das Werk baut nun Getreide für eine Geflügelfabrik in der Regionalhauptstadt Tula an und liefert Raps und Sonnenblumen für eine Butterfabrik in die nächstgrößere Stadt Orjol. „Früher hatten wir Kühe, Schweine, Geflügel. Das Leben brodelte“, sagt Inessa und klingt bedauernd. „Niemand hat Russland je als Partner gesehen, alle wollten es vernichten. Und wir haben uns in den 1990ern, als hier alles brachlag, mit leckeren Essenspaketen aus dem Westen kaufen lassen. Was schmeckten mir damals als Jugendliche die Kaugummis!“, sagt Swetlana. „Aber wir lassen uns nicht mehr kaufen. Wir machen jetzt alles selbst.“
Das Dorf der Unerwünschten
Im Jahr 1932 hatten die Bolschewiki hier ein Dorf für die „Unerwünschten“ errichten lassen, die Repressierten des Stalin-Regimes, die sich stets mehr als 100 Kilometer von städtischen Zentren anzusiedeln hatten. „Diktatur des Proletariats“ hätte der Ort heißen sollen. Geblieben ist Diktatura, bis heute. „Ein dämlicher Name“, sagt Inessa. „Ein Name, für den ich mich früher schämte und wünschte, mein Dorf könnte etwas positiver klingen“, sagt Grischina. „Wir kommen aus der Diktatur, wie klingt denn das?“, fragen beide fast gleichzeitig. Wie etwas Wahres?
Die beiden lachen laut und wehren sofort ab: „Wir verstehen nichts von Politik, wir sind der Politik vollkommen fern. Wir sind einfache Leute. Wir können gar nicht beurteilen, was so los ist in der Welt. Wir leben nur unser bescheidenes Leben.“
Das sind Sätze, die einem Propaganda-Lehrbuch zu entspringen scheinen. Einem Werk, wie Menschen jegliches Selbstwertgefühl und jeglichen Zweifel zu verlieren haben und sich selbst quasi freiwillig zum Spielball von Herrscherinteressen machen. Die der Chance beraubt werden, zum Bürger oder Bürgerin des eigenen Landes zu werden, zum politischen Subjekt mit Rechten. Zum Ich. Sie finden sich damit ab. Sie wiederholen menschenverachtende Sätze, erliegen zynischen Narrativen und sprechen über eigene Wunden so schmerzfrei, als hätten sie ihre Gefühlsverarbeitung im Gehirn einfach per Knopfdruck abgestellt.
„Es ist so, nichts zu machen“, ist ein Satz, der scheinbar mit ihr verwachsen ist. Die Heizung in ihrer Bibliothek laufe seit Jahren nicht mehr? Ihre Rente reiche kaum zum Leben? Der Enkel ihrer Nachbarin sei gefallen? „Es ist so, nichts zu machen.“ Im Fernsehen daheim: Kriegsrauschen samt Hassgebrüll. „Mindestens vier Stunden täglich. Ich schaue mir das alles an und verstehe doch nicht, was Sache ist. Haben wir denn wirklich die Ukraine überfallen? Sind wir denn wirklich schuld? Das kann nicht sein. Wir sind Sieger, wir waren immer Sieger“, sagt sie. Nüchtern. Sachlich.
Sie packt ihre Plastiktüte zusammen, macht sich auf zur Schule. 1989 war der graue Plattenbau für 200 Schüler gebaut worden, unterrichtet werden da lediglich 13 Jungen und Mädchen. Mit ihnen will Grischina an diesem Nachmittag Karten für die Soldaten an der Front malen. „Schade nur, dass unser Club verfallen ist, sonst hätten wir dort genügend Platz zum Flechten von Tarnnetzen.“ Ein freundliches Gesicht hat sie. Ein gütiges, das Schaudern hervorruft. Es gibt viele solcher Gesichter in Russland.
Einen Ort namens Demokratie gibt es in Russland nicht.