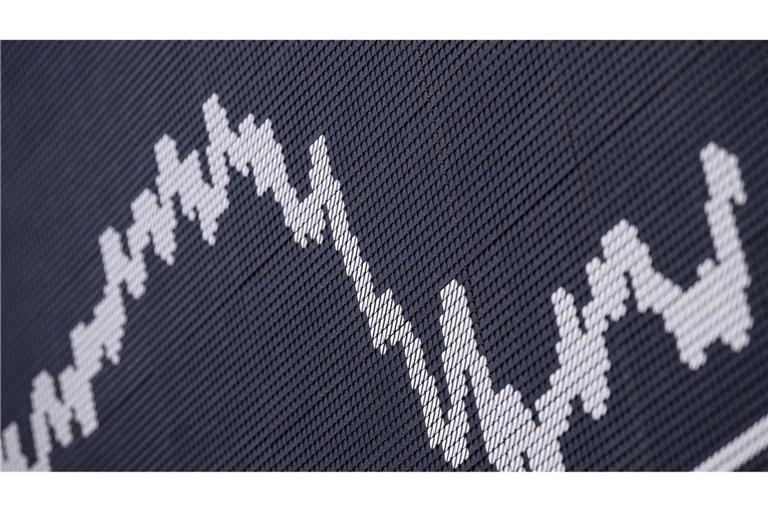Wie wird die Bahn fit für die Zukunft?
Fünf Aufgaben für eine bessere Bahn
Wie sollte die künftige Bundesregierung den Schienenverkehr neu aufstellen? Ein SCI-Vergleich mit fünf Ländern nennt die wichtigsten Erfolgsfaktoren.

© dpa/Jens Büttner
Kann eine Pkw-Maut mehr Leute dazu bewegen, vom Auto auf die Bahn umzusteigen? Die Studie gibt Antworten.
Von Thomas Wüpper
Noch steht nicht fest, wer nächster Bundesverkehrsminister wird. Klar ist aber, dass es viel zu tun gibt. Denn der Schienenverkehr in Deutschland weist viele Schwachstellen auf. Was machen andere Länder besser und was kann man davon lernen? Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat die auf Bahnthemen spezialisierten Berater von SCI Verkehr beauftragt, diese Fragen zu beantworten. Die Ergebnisse können der nächsten Regierung als Fahrplan zu einer besseren Bahn dienen.
In der umfangreichen Datenanalyse, die unserer Redaktion vorab exklusiv vorliegt, wird der deutsche Bahnverkehr mit den Systemen in der Schweiz, Österreich, Frankreich, Spanien und Polen verglichen. Die drei SCI-Experten Alexander Borchers, Maria Leenen und Tristan Mittelhaus haben daraus fünf zentrale Handlungsfelder für eine Wende in der Bahnpolitik abgeleitet.
Was machen Österreich und Frankreich besser?
Erstens ist demnach eine eine gesicherte überjährige Finanzierung der Schiene nötig, die sich zweitens in Umfang und Ausrichtung ehrlich am Ziel einer leistungsfähigen Bahn orientieren muss. Drittens sollte der Staat die direkte Verantwortung für die gemeinwohlorientierten Unternehmensteile wie die Infrastruktur übernehmen. Viertens sollte konsequent auf Digitalisierung und fünftens auf eine integrierte Verkehrspolitik gesetzt werden.
„Für die anstehenden strategischen Entscheidungen liefert die neue Studie nun wichtige Zahlen und Fakten“, sagt Christina Schildmann, Leiterin der Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung. Demnach ist in der Schweiz und Österreich, den beiden Nachbarländern mit deutlich leistungsfähigerem und zuverlässigerem Bahnverkehr, vor allem die gesicherte überjährige Finanzierung ein wichtiger Erfolgsfaktor. Durch gesicherte längere Zeitspannen seien wirtschaftlicheres Handeln und effizientere Mittelverwendung möglich. Die Bahnunternehmen würden weniger durch kurzfristige Etat-Engpässe bedroht.
Mit Blick auf die viele Jahre lang unzureichende Finanzierung der Infrastruktur in Deutschland betonen die Autoren, dass nur eine ausreichende Mittelausstattung ein qualitativ hochwertiges, resilientes Netz und stabilen Bahnbetrieb sichert. Nötig seien dafür verbindliche Zielvereinbarungen zwischen Politik und Bahn und ein „ehrlicher Umgang“ miteinander.
Zudem halten die Experten eine klare Differenzierung zwischen gemeinwohl- und wettbewerbsorientierten Unternehmensbereichen für nötig. Deutschland habe das mit der Gründung der DB Infra-Go begonnen, müsse diesen Ansatz aber „noch ausbauen“. Offen lässt die Studie die Frage, ob Netz und Betrieb wie bisher unter dem Dach der Deutschen Bahn AG fortgeführt oder die bundeseigene Infrastruktur besser herausgelöst und unabhängig aufgestellt werden sollte. Für beide Lösungen gebe es erfolgreiche Beispiele.
Konkurrenz in Spanien – Preise sinken
So setzen die Schweiz und Österreich als Länder mit dem höchsten Schienenanteil auf integrierte Bahnsysteme wie Deutschland. Spanien wiederum zeige mit der Trennung von Netz und Betrieb im Hochgeschwindigkeitsverkehr „eine starke Leistung“, dort konkurrieren drei Anbieter mit hochmodernen Zügen um Fahrgäste und die Preise sind durch den Wettbewerb deutlich gesunken. Auch in Polen habe die eigene Infrastrukturgesellschaft zu erheblichem Wachstum geführt, die Produktivität sei aber noch unzureichend. In Frankreich wiederum habe die Wiedereingliederung von Netz und Betrieb seit 2015 keine überdurchschnittlichen Fortschritte gebracht.
Für wichtiger als die Frage der Trennung hält die Studie eine systematische Digitalisierungsstrategie für das bereits hoch belastete Schienennetz. ETCS, digitale Stellwerke und die Digitale Automatische Kupplung im Güterverkehr erforderten entschiedene Schritte, damit Bahnindustrie, Betreiber und Zulieferer planen können. Nötig seien verbindliche Zeitpläne mit Meilensteinen und einer verlässlichen Finanzierung.
CO2-Vermeidung erforderlich
Schließlich halten die Autoren auch „eine verkehrsträgerübergreifende Politik der CO2-Vermeidung“ für erforderlich. Die Schweiz und Österreich erreichten den hohen Schienenanteil zum einen durch massive Investitionen in die Bahn, aber auch durch begleitende Maßnahmen wie Lkw-Nachtfahrverbote und Maut im Straßenverkehr. Zur Förderung der Bahn könnten auch Maßnahmen wie die CO2-Bepreisung und die Sicherung des Deutschlandtickets dienen.
SCI hat für die Studie „Schienenverkehr im europäischen Vergleich: Empfehlungen für eine bessere Bahn in Deutschland“ zentrale Kennzahlen wie Marktgröße, Regulierung, Investitionen und betriebliche Leistung untersucht. Detailliert erfasst worden sind demnach für jeweils alle untersuchten Länder die Branchenstruktur, Markttrends, Beschäftigungsentwicklung und Innovationen. Die Untersuchung lade ein zu Debatten und zu „mutigen Entscheidungen“ für besseren Schienenverkehr, betont die Hans-Böckler-Stiftung.