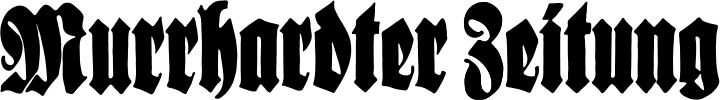Flüchtlinge
Integrationsbeauftragte: „Wir müssen auf unsere Sprache achten“
Wie gelingt Integration? Und ist sie möglich, wenn so viele Menschen kommen wie im vergangenen Jahr? Reem Alabali-Radovan ist Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration – und hat eine klare Meinung zur aktuellen Debatte.

© photothek.de/Ute Grabowsky
Seit 2021 ist Reem Alabali-Radovan Staatsministerin im Kanzleramt.
Von Tobias Peter und Rebekka Wiese
Als Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration empfängt Reem Alabali-Radovan (SPD) ihre Gäste in einem großen und hellen Büro im Kanzleramt. Hier zurücklehnen kann sich die Politikerin aber wohl kaum. Im Interview spricht sie darüber, weshalb sie die aktuelle Debatte um Migration besorgt – und sie erklärt, wie Integration besser gelingen könnte.
Frau Staatsministerin, Sie haben Erfahrung als Hobbyboxerin. Gibt es beim Boxen etwas, was man für den Kampf gegen Rassismus lernen kann?
Beim Boxen geht es um Respekt und Toleranz, man begegnet sich auf Augenhöhe. Das ist etwas, das mir auch bei meiner politischen Arbeit hilft. Und man lernt Ausdauer. Die ist vor allem beim Kampf gegen Rassismus sehr wichtig.
In einer Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung gab fast ein Viertel der Befragten mit Migrationshintergrund an, dass sie angesichts der Erfolge der AfD erwägen, Deutschland zu verlassen. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, wenn ich mit Menschen mit Einwanderungsgeschichte spreche, höre ich oft von solchen Überlegungen. Ich kann das gut nachvollziehen. Wie wir in Deutschland gerade über Migration sprechen, verunsichert viele, da wir oft eine Sündenbockdebatte führen. Es ist extrem beunruhigend, wenn die AfD mit ihrer rassistischen Politik erfolgreich ist.
Entmutigt Sie das als Staatsministerin für Integration?
Wir müssen das sehr ernst nehmen als Staat und als Gesellschaft, wenn sich Menschen mit Einwanderungsgeschichte um ihre Zukunft in diesem Land sorgen. Wir dürfen das nicht einfach als eine Gefühlslage abtun. Wir sind ein Einwanderungsland, wir wollen das auch bleiben. Deshalb treibt mich die Debatte eher an, dass wir umso dringender etwas tun müssen für unseren Zusammenhalt und gegen Rassismus.
Was denn?
Wir müssen auf unsere Sprache achten, wenn wir über Migration, Asyl und Flucht sprechen. Worte sind Macht. Und Worte werden zu Taten, wie wir an der enorm gestiegen Anzahl an Übergriffen feststellen. Deshalb appelliere ich vor allem auch an die demokratischen Parteien: Natürlich müssen wir über Migration sprechen – aber bitte sachlich. Ohne Generalverdacht und populistische Scheinlösungen. Darüber hinaus brauchen wir wirksame Instrumente, wie das Demokratiefördergesetz, mit dem unter anderem die Förderung von Initiativen gegen Rechtsextremismus verstetigt werden soll. Das muss endlich kommen. Und als Beauftragte für Antirassismus habe ich auch dafür gesorgt, dass mehr Beratungsstellen für Betroffene von Rassismus eingerichtet werden. Vor allem im ländlichen Raum und verstärkt auch in Ostdeutschland.
Mehrere Bundestagsabgeordnete wollen einen Antrag in den Bundestag einbringen, um ein AfD-Verbot prüfen zu lassen. Fänden Sie ein AfD-Verbot richtig?
Wir müssen die AfD politisch bekämpfen, aber wir müssen sie auch juristisch stellen. Wenn Landesverbände einer Partei gesichert rechtsextrem eingestuft sind, muss das Konsequenzen haben. Deshalb bin ich dafür, dass ein Verbot der Partei weiter geprüft wird. Der Verfassungsschutz sammelt Informationen darüber, ob nicht nur einzelne Landesverbände, sondern die gesamte Partei als gesichert rechtsextrem eingestuft werden muss. Aktuell müssen wir noch eine wichtige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Beobachtung der AfD abwarten. Am Ende gilt: Wenn ausreichend Beweise vorliegen, müssen wir ein Verbotsverfahren anstoßen. Die Demokratie muss wehrhaft sein.
Dass aktuell viel über Migration gesprochen wird, liegt nicht nur an der AfD. Die Debatte geht zurück auf die hohe Zahl von Asylbewerberinnen und -bewerbern, die im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen sind. Viele Kommunen waren überlastet. Was das zu viel?
Es war eine Herausforderung, die man nicht kleinreden darf. Allein aus der Ukraine haben wir fast eine Million Geflüchtete in kürzester Zeit aufgenommen. Das war eine enorme Leistung. Und das hat ganz deutlich gezeigt: Wir müssen darüber sprechen, wie wir die Kommunen krisenfest für die Zukunft aufstellen können. Wir steuern und wir ordnen Migration, aber es werden weiter Menschen zu uns kommen, die wir integrieren müssen und wollen, ob es nun Geflüchtete sind oder Fachkräfte. Wir sind ein Einwanderungsland und auf Migration auch angewiesen.
Und was sollte Ihrer Meinung nach passieren?
Im vergangenen Jahr hat der Bund eine langfristige, nachhaltige Finanzierung der Flüchtlingsversorgung mit den Bundesländern ausverhandelt. Jetzt geht es auch um die Frage, wie sich die Kommunen besser aufstellen. Aktuell ist Integration eine freiwillige Aufgabe. Das heißt, Kommunen können selbst entscheiden, ob und wie sie Integration gestalten. Wir sollten Integration besser zur Pflichtaufgabe der Kommunen machen, sie also gesetzlich dazu verpflichten, aber eben auch verlässlich planbar finanziell dafür aufstellen.
Woher soll das Geld dafür kommen?
Es ist völlig klar, dass wir die Kommunen mit der Aufgabe Integration nicht allein lassen. Bund und Länder müssen verlässlich unterstützen – auch wenn die Haushaltslage schwierig ist. Wir sind ein Einwanderungsland und können nicht so tun, als sei Integration eine kurzfristige Aufgabe, die bald abgehakt ist. Wir brauchen Integrationskurse, Migrationsberatungsstellen, psychosoziale Beratung – und zwar nicht in kurzfristigen Projekten, sondern auf Dauer angelegt. Die Investition hier zahlt sich auf der Strecke langfristig aus.
Oft heißt es, dass Arbeit der wichtigste Schritt zur Integration sei. Viele Geflüchtete, die in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen sind, sind inzwischen gut in den Arbeitsmarkt integriert. Anders sieht es aber bei den ukrainischen Kriegsflüchtlingen aus. Warum ist das so?
Das hat verschiedene Gründe. Eine große Herausforderung ist die Sprache. Es dauert einfach lang, Deutsch so zu lernen, dass es für den Arbeitsalltag ausreicht. In anderen Ländern geht es oft flexibler mit dem Erlernen schon im Job. Eine andere Herausforderung ist, dass es immer noch sehr kompliziert ist, ausländische Studien- und Berufsabschlüsse anerkennen zu lassen. Das ist frustrierend für Arbeitgeber und Arbeitende gleichermaßen. Da brauchen wir dringend viel mehr Pragmatismus und Flexibilität.
Hält das Bürgergeld die Betroffenen davon ab, sich um Arbeit zu bemühen?
Nein. Das Bürgergeld ist nicht der Grund, weshalb Betroffene sich keinen Job suchen. Das zeigen Studien und es ist auch mein persönlicher Eindruck. Es braucht einige Zeit, um sich in einem neuen Land zurechtzufinden und das Leben neu einzurichten, besonders mit einer Fluchterfahrung hinter sich. Ich bin selbst als Kind als Geflüchtete nach Deutschland gekommen und erinnere mich gut, dass das bei meinen Eltern auch so war. Die allermeisten Migrantinnen und Migranten wollen so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen und ihren Lebensunterhalt selbstständig sichern.
Sie sind Staatsministerin im Kanzleramt und stehen in engem Austausch mit Olaf Scholz. Was war der wichtigste Ratschlag, den Sie ihm gegeben haben – und hat er auf Sie gehört?
Wir sehen uns ja sehr regelmäßig jede Woche im Kabinett und stehen im Austausch. Meine Aufgabe ist es auch, den Bundeskanzler in meinen Themenfeldern Integration und Antirassismus zu unterstützen. Vor einigen Monaten haben wir beispielsweise gemeinsam Menschen mit Einwanderungsgeschichte eingeladen, die sich um ihre Zukunft in diesem Land sorgen. Darunter waren Migrantenorganisationen, Überlebende des Anschlags von Hanau und Angehörige der jüdischen Gemeinde. Das war ein sehr wichtiges Treffen, um denjenigen eine Stimme zu geben, die sonst nicht im Kanzleramt ein und aus gehen.
Das Gespräch führten Tobias Peter und Rebekka Wiese.
Zur Person
PolitikReem Alabali-Radovan, geboren 1990, ist seit 2021 als Staatsministerin für Integration, Migration und Flüchtlinge im Kanzleramt, seit 2022 ist sie außerdem Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. 2021 trat sie der SPD bei, im selben Jahr wurde sie für die Partei über Landesliste in den Bundestag gewählt. Zuvor war Alabali-Radovan Integrationsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern im Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung. Sie studierte Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.
PersönlichesAlabali-Radovan ist in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, dort lebt sie bis heute. Ihre Eltern stammen aus dem Irak, mit ihnen kam Alabali-Radovan als Kind nach Deutschland, wo die Familie Asyl erhielt.