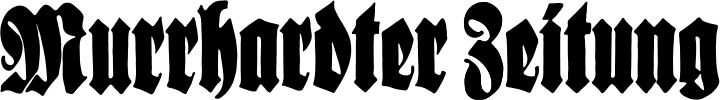Vom ersten Pfund Zimt in der Klosterküche
Die vielen Gewürze und speziellen Zutaten der heutigen Weihnachtsbäckerei sind mit Blick in die Geschichtsbücher alles andere als selbstverständlich und doch orderte beispielsweise auch das Murrhardter Kloster schon im 16. Jahrhundert Zimt sowie venezianische Mandeln.

© Alexander Becher
Zimtsterne sind immer noch ein Klassiker der Weihnachtsbäckerei. Heute weiß man mehr um die positiven Aspekte des Gewürzes.
Von Karin de la Roi-Frey
Murrhardt. Jetzt, zur Weihnachtszeit, erinnern sich wohl so manche noch einmal gerne an ehemalige Bäckereien und Cafés in Murrhardt, in denen es vor Weihnachten so verheißungsvoll duftete. Vielleicht nach süßlich-wärmendem Zimt, der nun wieder seine große Zeit hat. In den vergangenen Monaten eher selten verwendet, gehört er nun unbedingt zu Zimtschnecken, Zimtsternen, Bratäpfeln und Lebkuchen, aber auch zu Kaffee und Kakao und für Feinschmecker auch zu Wild- und Fleischgerichten. Der Orient hält Einzug in die Küchen, denn über die Gewürzstraße und den Hafen von Venedig kam dieses Gewürz zu uns. Schon für 1453 sind Zimthändler bekannt, etwa 100 Jahre später erscheint dieses Gewürz auch in den „Naturalausgaben“ des Klosters Murrhardt.
Feine Süßigkeiten als Medizin
So berichtet Gerhard Fritz es in der „Murrhardter Sozialgeschichte“ und nennt für 1568/69 eine Menge von einem Pfund und zwölf Lot (je 15,6 Gramm) Zimt. Wenn auch sehr teuer und schwer zu beschaffen, gehörte Zimt doch schon damals unabdingbar zu bestimmten Backwaren, die von Klöstern zu Weihnachten an Arme verteilt wurden. Dabei stand nicht der Genuss im Vordergrund, diese feinen Süßigkeiten galten auch lange als Medizin. So regt Zimt den Appetit an, senkt den Blutzuckerspiegel und wirkt durchblutungsfördernd. Und der Geruch von Zimt soll die Produktion des Glückshormons Serotonin anregen. Das wusste man in diesen Zeiten nicht im Einzelnen, man sah aber das positive Ergebnis. Und so könnte der Lebkuchen einst „Lebenskuchen“ oder „Labekuchen“ geheißen haben und für das althochdeutsche „leb“ für „Heil- und Arzneimittel“ stehen. Bekannt ist, dass sich die enthaltenen Gewürze Kardamom und Anis positiv auf den Körperhaushalt auswirken. Marzipan galt als „Kraftbrot“ für Kranke und Wöchnerinnen. Auch dem einen oder anderen lendenlahmen Murrhardter soll es geholfen haben.
Keltisches Brot aus Getreide und Honig
Die weihnachtlichen Süßigkeiten sind Tradition, schon die Kelten stellten zur Zeit der Wintersonnenwende Brot aus Honig und Getreide her, um es den Göttern zu reichen. In jüngerer Vergangenheit brachten viele Murrhardterinnen ihre Bleche voller Gutsle zum Abbacken in eine der örtlichen Bäckereien. Paradiesische Düfte von Bärentatzen, Haselnuss-, Terrassen- und Hildabrötle, Spitzbuben, Zedernbrot, Mandelmakronen, Zimtsternen und Vanillekipferl breiteten sich aus. Und die gefürchteten Springerle? Oh weh, wenn sie keine „Füßle“ kriegten! Weihnachten ohne Gutsle? Undenkbar, und doch in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs fast Alltag in Deutschland. Fliegeralarm, Sirenengeheul, fallende Bomben, brennende Häuser und Lebensmittelnot bestimmten das Leben der Menschen. So erhielten deutsche Hausfrauen in der Zeit vom 17. November bis zum 14. Dezember 1941 für zwei Abschnitte auf der Reichseierkarte ein (!) Hühnerei für die Weihnachtsbäckerei. „Gutsle bacha ond Kuache, do hosch bloß drvo träuma könna“, erinnert sich eine Stuttgarterin. „Sorga, Angst ond Not isch alltäglich gwä, Weihnachta ond Silvester passé.“
Spätere Generationen erinnern sich an Blechtrommeln voller Kuchen, der durch ein Vorhängeschloss (!) gesichert war, an „so nie gesehenes, märchenhaftes Zuckerzeug“ auf dem Weihnachtsteller und auch an das Singen der (armen) Kinder an Heiligabend vor den Haustüren: „Und schon ist meine Großmutter mitten zwischen ihnen, die alte, geschäftige Frau, den Speisekammerschlüssel am kleinen Finger, einen Teller voll Gebäck in der Hand. Wie blitzschnell das verschwindet!“ So erging es auch einem in sehr noblen Umständen gebackenen Weihnachtskuchen. Wilhelm von Humboldt besuchte Goethe zu Weihnachten 1826 in Weimar und sah ihn „des Morgens eine solche Portion Napfkuchen zu dem Wein verzehren, dass es mich wirklich wunderte“. Und dass Goethe anlässlich einer Weihnachtseinladung die Äpfel, Nüsse und das Zuckerzeug, mit denen der Baum geschmückt war, in aller Heimlichkeit vernaschte, ist auch überliefert. Muss also etwas dran sein, wenn Zeitgenossen über ihn sagten: „Er frisset entsetzlich.“
Kloster orderte venezianische Mandeln
Vanillekipferl gab es zu dieser Zeit nur in sehr wenigen Häusern. Wer konnte sich das gemeinsam mit Kakao um 1520 aus Mittelamerika nach Europa eingeführte Vanillin schon leisten? Über Jahrhunderte war es ein Luxusgut. Auch in den „Naturalausgaben“ des Klosters Murrhardt taucht es Mitte des 16. Jahrhunderts nicht auf, wohl aber fünf Pfund venezianische Mandeln. Mandelmakronen, wohl das älteste Weihnachtsgebäck, stammen aus den venezianischen Klosterküchen des 8. Jahrhunderts und Printen wie Spekulatius kamen aus Belgien und den Niederlanden zu uns. Die aufgeprägten Motive wurden einst mit einer Holz- oder Metallvorlage in den Teig geprägt und gaben dem beliebten Gebäck seinen Namen, bedeutet „speculum“ doch Abbild oder Spiegel. Und in Murrhardt kommt wieder das alljährliche Hutzelbrot in den Ofen. Neben vielen Zutaten gehören auch getrocknete Birnen hinein und vielleicht hat die Murrhardter Hausfrau dafür noch immer einen Gaishirtlebaum im Garten. Sehr süß und aromatisch schmecken diese einst angeblich in Gaisburg zuerst gepflanzten, heute fast vergessenen Birnen. Manche sagen auch, ein Ziegenhirte hätte sie als Erster entdeckt, worauf sie „Geishirtl“ genannt wurden. Der Dichter Eduard Mörike lässt im Märchen „Das Stuttgarter Hutzelmännlein“ eben jenen diese Köstlichkeit erfinden: „Das Hutzelbrot ich hab erdacht, auch viele seltsame Streich gemacht.“ Wie das Hutzelbrot nun auch in die Welt und die Birne zu ihrem Namen kam, Kaspar Schiller, der Vater von Friedrich, wusste eines genau: „Das Gaishirtle ist eine unserer besten Sommerbirnen.“ Erst um 1600 erschienen die ersten Stollenrezepte in Backbüchern. Der Grund? Alle Zutaten außer dem Mehl waren im Gegensatz zum Schnitzbrot sehr teuer und für die meisten unerschwinglich. Der üppige Dresdner Weihnachtsstollen verdankt seinen Namen dem Stollenkrieg von 1615.
Stollenbäcker aus Sachsen, die diese weihnachtliche Köstlichkeit schon um 1300 gebacken haben sollen, lieferten bis dahin nämlich ihren Stollen auch nach Dresden. Die dortigen Bäcker überfielen kurzerhand ihre Konkurrenz und zündeten deren Wagen an. Später erhielten die Dresdner Stollenbäcker vom Kurfürsten ein Stollenprivileg für ihre Stadt. Und so gibt es bis heute den echten Dresdner Stollen nur in Dresden. Und während alle in den weihnachtlichen Backstuben tätig sind, legt der schwer beschäftigte schwäbische Nikolaus, der landauf, landab unterwegs ist, eine kleine Pause ein und freut sich: „Do kommt scho dr Nochschub vom Engelbeck! Lebkucha, Marzipan, Makrona! Guad, manchmal duat mei Job sich lohna!“

© Alexander Becher
Früher wurden Backwaren von Klöstern an Arme verteilt. Archivfotos: Alexander Becher