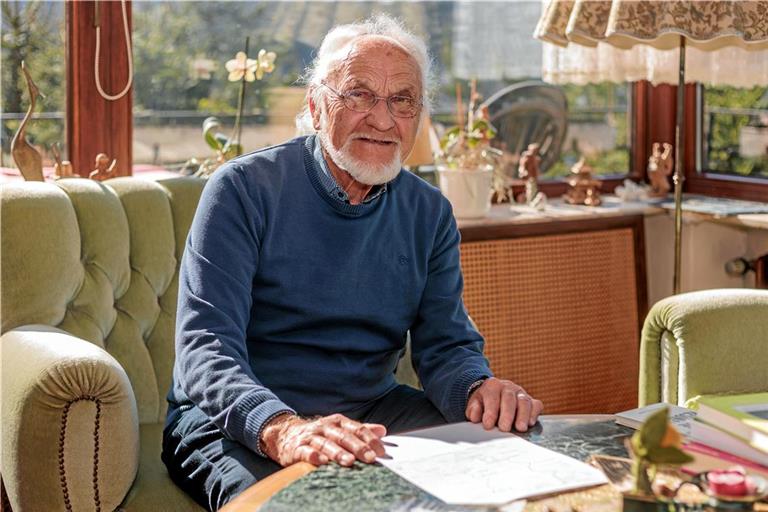Von Blockwarten und Kriegsgefangenen
Vor 75 Jahren: Erinnerungen an die Nachkriegszeit in Murrhardt (6) In Murrhardt gab es eine SS-Abteilung und einige rangniedrige NS-Funktionäre. Das Verhältnis zu Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern unterschied sich je nach Land deutlich.
Von Elisabeth Klaper
MURRHARDT. Zwar setzten sich viele Familien der Walterichstadt nicht aktiv mit den Verbrechen des NS-Regimes auseinander, doch einige Personen wussten Bescheid, und manche setzten sich für Verfolgte ein. Dies verdeutlichen die Aussagen verschiedener Zeitzeugen. „In unserer Familie waren die Judenverfolgung und -vernichtung nie ein Thema“, erinnert sich Marianne Schurr, die auf einem Bauernhof in Hausen aufwuchs, wohl auch weil in der Walterichstadt keine Juden lebten. Indes war ihr Vater „Mitglied einer kleinen Abteilung der allgemeinen SS in Murrhardt“.
Dieser gehörten laut Heimatgeschichtsforscher Christian Schweizer meist Beamte an, die zum Beispiel im Forstamt und bei der Polizei tätig waren. Diese SS-Abteilung war nur einmal im Einsatz, als ein schweres Eisenbahnunglück bei Schleißweiler im Dezember 1934 etliche Tote und Verletzte forderte. Sonst trat sie bei NS-Veranstaltungen, Feiertagen und Aufmärschen auf. „Nach Kriegsende war mein Vater etwa ein halbes Jahr in einem Gefangenenlager der Amerikaner in Oßweil, und bei einem Arbeitseinsatz im Sägewerk Morlock kam er kurz zu Besuch nach Hause.“ Laut Marianne Schurr gab es in der Walterichstadt einige rangniedrige NS-Funktionäre, darunter auch die sogenannten Blockwarte. Sie kontrollierten die Einwohner, damit diese sich im Alltag stets entsprechend den Vorgaben des NS-Regimes verhielten. Während des Krieges hatten sie zudem „eine sehr wichtige Aufgabe: Sie sorgten dafür, dass bei Luftalarm, wenn die Sirenen losgingen, alle Einwohner so schnell wie möglich in die Luftschutzkeller und -stollen gingen. Diese befanden sich an verschiedenen Orten, so an der Siegelsberger Straße gegenüber der Rümelinsmühle, beim ehemaligen Café Riesberg, beim Gaswerk sowie an den Hängen rings um die Innenstadt“, erklärt Schurr.
Annemarie Meindls Vater war Schneider und wurde als Soldat mehrfach schwer verwundet. „Sein rechter Arm war ab dem Ellenbogen nur noch sehr eingeschränkt funktionsfähig, deshalb stellte er seine Arbeitsweise auf die linke Hand um.“ Er sei in einem Lazarett in Bamberg gewesen, wo schreckliche Zustände herrschten. „Viele schwer verletzte Soldaten konnte man ob des Mangels an Medikamenten nicht behandeln und Schmerzen nicht lindern, wahrscheinlich bekamen sie auch nicht genug zu essen.“ Trotzdem sei ihr Vater von dort geflohen und teils zu Fuß, teils mit diversen Fahrgelegenheiten nach Hause gekommen.
Die Amerikaner verhafteten ihn, worauf er ins große Gefangenenlager Holzheim bei Göppingen kam, und der zuständige Arzt behandelte ihn erfolgreich. Ihre Mutter und eine Bekannte besuchten ihn mit dem Fahrrad und brachten ein Päckchen mit Lebensmitteln und Bedarfsartikeln. „Doch die Amerikaner hatten Angst, dass die Gefangenen Waffen bekommen und einen Aufstand anzetteln könnten. Darum kontrollierten sie alle Päckchen genau und gingen sehr rigoros gegen Gefangene vor, die sich nicht an die Spielregeln hielten. Mein Vater wurde entnazifiziert, weil er Parteimitglied war, und die US-Militärregierung schloss unsere Schneiderei für 14 Tage. Für das Verfahren musste er einen großen Fragebogen ausfüllen und Zeugen finden, die bestätigen konnten, dass er nicht an NS-Verbrechen beteiligt war. Viele Lehrer durften nicht mehr unterrichten, weil sie vom Dienst suspendiert oder deren Entnazifizierungsverfahren noch nicht abgeschlossen waren. Vor der Spruchkammer mussten sich die betroffenen Personen im Rahmen des Entnazifizierungsverfahrens verantworten, und Zeugen sagten über deren Tätigkeit und Aktivitäten während der NS-Zeit aus.“
Zeitzeuge Wilhelm Wieland erinnert daran, dass auch in der Walterichstadt zeitweise Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter lebten. „Ab 1940 waren französische Kriegsgefangene im späteren Feuerwehrgerätehaus im Klosterhof untergebracht und vor allem in der Landwirtschaft auf Bauernhöfen als Helfer tätig. Die Einwohner behandelten sie gut.“ Später kamen russische Kriegsgefangene, die in der alten Turnhalle untergebracht waren. „Normalerweise durften sie nicht arbeiten, nur bei besonderen Vorkommnissen. Als ein Heuwagen vor der Sonne-Post zusammenbrach, mussten sie das Heu auf einen anderen Wagen umladen. Sie durften keine Lebensmittel von den Einwohnern bekommen, trotzdem ließen manche ihnen verbotenerweise etwas zukommen und warfen es über den Zaun.“ Laut Wieland kamen in der zweiten Kriegshälfte meist aus Polen und Russland auch verschleppte Zwangsarbeiter: „Eine kleine Gruppe war in der Fornsbacher Straße in einer Durchgangsunterkunft und Sammelstelle untergebracht. Manche wollten zurück in die Heimatländer, andere konnten dies nicht und suchten in Westdeutschland eine neue Bleibe. Zwischen diesen Zwangsarbeitern und der breiten Bevölkerung gab kaum Begegnungen. Denn nähere Beziehungen zu Deutschen waren für Osteuropäer lebensgefährlich, und Deutsche bekamen entehrende Strafen“, erläutert der Zeitzeuge (siehe auch Bericht unten).