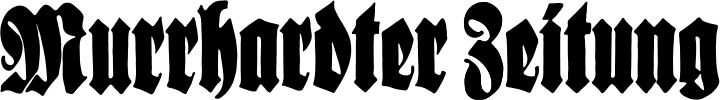Von der Barbarei, Christbäume zu fällen
Die Tradition, sich eine Tanne in die gute Stube zu stellen, ist noch gar nicht so alt. Auch Kritiker ruft der Brauch früh auf den Plan, wie der Blick in die Geschichtsbücher zeigt. Hinzu kommen regionale Unterschiede – auf den Nordseeinseln ist das Pendant der Julbogen.

© Stefan Bossow
Den Murrhardter Marktplatz schmückt ein stattlicher Baum. Dieser Brauch entwickelte sich erst nach und nach im Südwesten. Foto: Stefan Bossow
Von Karin de la Roi-Frey
Murrhardt. Eines haben der berühmte Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center in New York und der auf dem Stuttgarter Schlossplatz gemeinsam: Das ganze Jahr wird Ausschau gehalten nach einem geeigneten Exemplar. Manchmal dauert es ein Jahr, bis aus dem Hubschrauber in einem US-Staat der Weihnachtsbaum gesichtet und auf einem Speziallaster mit Polizeieskorte nach New York gebracht wird. Die Stuttgarter hatten es dieses Jahr leichter. Aus Sulzbach an der Murr, genauer Bushof, kommt eine Weißtanne für den Schlossplatz (wir berichteten). Vor 60 Jahren wurde sie zur Begrüßung eines neugeborenen Familienstammhalters gepflanzt und reiste nun nachts per Schwertransport in die Landeshauptstadt. Mit 24 Metern Höhe ist sie nur einen Meter kleiner als der viel bestaunte und bewunderte Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center. Geschmückt mit 50000 bunten Lichtern und einem 400 Kilogramm schweren Stern an der Spitze ist er eine alljährliche Attraktion. Diese haben die New Yorker letztendlich der Inflation in den 1930er-Jahren zu verdanken, als der Bauherr Rockefeller seine Arbeiter aus der Privatschatulle bezahlte, um ihnen und ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen. Zum Dank zogen die Bauarbeiter einen Tannenbaum hoch ins schon fertig gestellte Stockwerk. Das war der Beginn dieser Weihnachtstradition, die Tausende verfolgen, wenn zum ersten Mal die Lichter angezündet werden.
Bäcker bestücken den Baum für die Kinder mit Früchten und Naschwerk
Es heißt, Auswanderer hätten den Weihnachtsbaum mit nach Amerika gebracht. Und nach England, wo traditionell die Mistel das Weihnachtsfest schmückt, soll er zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit dem zukünftigen Mann von Queen Viktoria, Prinz Albert von Sachsen-Coburg, gekommen sein. Gut möglich, denn 1419 soll die Freiburger Bäckerzunft Bäume mit Früchten und Backwerk zum Herunterschütteln für die Kinder aufgestellt haben. 1598 durften angeblich Schneidergesellen in Basel einen Baum voller Äpfel an Dreikönige abschütteln. Und 1605 heißt es: „Auf Weihnachten richtet man Dannenbäum zu Straßburg in den Stuben auf, daran henket man Rosen aus vielfarbigem Papier geschnitten, Äpfel, Oblaten, Zucker“, auch Ähren und Gestaltengebäck – in Erinnerung an die Opfergaben der Germanen. Um diese Zeit beginnt der Siegeszug des Weihnachtsbaums, den manche Theologen denn auch noch lange Zeit als „Lappalie“ gegen das „Wort Gottes“ bezeichnen. Dass Martin Luther (1483 bis 1546) mit seiner Familie unter einem geschmückten Tannenbaum saß, ist ein Märchen. Zu dieser Zeit holte seine Frau Katharina, von ihm respektvoll manchmal „Herr Käthe“ genannt, schon vor dem Fest Zweige von Obstbäumen oder Forsythien ins Haus. Diese Barbarazweige, die an die heilige Märtyrerin und ihren qualvollen Tod (4. Dezember 306) erinnern, gelten bis heute als Symbol des Lebens, der Hoffnung und des Glaubens. „Christmaien“, in denen der Mai für das sich zu Weihnachten hoffentlich zeigende grüne Laub steht, waren in vielen ländlichen Gegenden wie „uff em Wald“ noch sehr lange Tradition. Wohnhäuser und Scheuern waren aus Holz gebaut und mit Stroh gedeckt, die Angst vor Feuer war allgegenwärtig. Dabei gehörten zum ganz ursprünglichen Weihnachtsbaum auch keine Lichter, sie kamen erst 1611 durch die Idee der Herzogin Dorothea Sibylle von Schlesien an den Baum. Und über 400 Jahre später heißt es in den Kindheitserinnerungen eines Schwaben: „Dr Chrischtbum war vo de Wachskerza ond Wunderkerza hell erleuchtet.“
Für manche war ein Weihnachtsbaum nur dann so richtig schön, wenn er „besorgt“ worden war. Sozusagen eine „alte Tradition“, denn 1521 heißt es in den Rechnungsbüchern eines Städtchens im Elsass: „Vier Schillinge dem Förster zu bezahlen, damit er ab dem St.-Thomas-Tag (21. Dezember) die Bäume bewacht.“ Auch im Elternhaus von Friedrich Schiller (1759 bis 1805) musste man sich etwas einfallen lassen, wenn Vater Kaspar mal wieder seit zwei Jahren keinen Lohn aus der herzoglichen Kasse erhalten hatte und die Not groß war. „Das ist Weihnachtsbaumfrevel!“, tobte Herzog Carl Eugen (1728 bis 1793), der sein Geld lieber mit seinen „Ballettmädle“ ausgab als seine Männer zu bezahlen.
Herzog Carl Eugen geht gegen das
Schlagen von Christbäumen vor
Durch „Abschneiden von jungen Tannen zu den so genannten Christkindlensbäumen“ wird den Wäldern ein „unwiederbringlicher Nachtheil zugefügt“, schimpfte er. Und außerdem gehörte alles, was dort wuchs, lief und flog sowieso ihm, dem Landesherrn. Carl Eugen ging bei Strafandrohung energisch dagegen vor. Also höchste Vorsicht, wenn man sich in den dichten Murrhardter Wäldern einen Baum schlagen wollte. Und auch in Weimar wetterte man gegen die „Barbarei, Christbäume zu fällen“. Eine Waldordnung aus Lothringen dagegen erlaubt ausdrücklich das Schlagen eines Weihnachtsbaums bis zur Höhe von „acht Schuh“, also zweieinhalb Metern.
Diese Sorgen hatte man auf den Nordseeinseln über Jahrhunderte nicht. Auf der windigen, flachen Ebene in salziger Luft wuchsen keine Tannenbäume, folglich gab es auch keine Weihnachtsbäume. Man behalf sich zunächst mit baumähnlichen Gestellen, die mit ein wenig Grün von Buchsbaum, Efeu oder Krähenbeere geschmückt und mit Äpfeln und etwas Gebäck behängt wurden. Auch hier war von Lichtern keine Rede, wohnte man doch in reetgedeckten, oft windumtosten Häusern. Und dann Ende des 19. Jahrhunderts kam der viel reicher bestückte Julbaum oder Julbogen in die Häuser, steht bis heute in so mancher guten Stube und verzaubert nun auch mit Lichtern die Weihnachtszeit. Goethe, der sich einst selbst einen Weihnachtsbaum „besorgte“, dichtete 1821 anlässlich einer Weihnachtsfeier am Weimarer Hof: „Bäume leuchtend, Bäume blendend,/Überall das Süße spendend,/In dem Glanze sich bewegend,/Alt und junges Herz erregend“.