Kommunikation
Was bedeutet "Whataboutism"? - Bedeutung und Herkunft erklärt
Whataboutism ist eine Diskussionsform, bei der Gegenfragen und Themenwechsel eine konstruktive Debatte ausbremsen. Mehr zur Bedeutung, Entstehung und Tipps zum Umgang damit lesen Sie hier.
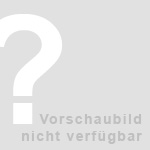
© ChristianChan / Shutterstock.com
Whataboutism gilt als Ablenkungstaktik durch ausweichende Reaktionen auf schwierige Fragen. Wie man damit umgeht.
Von Matthias Kemter
Inhalt:
- Was ist Whataboutism?
- Herkunft von Whataboutism
- Whataboutism erkennen
- Richtig reagieren & kontern
- Whataboutism & Strohmann-Argumente
Konstruktive Vergleiche können in Diskussionen helfen, Meinungen zu reflektieren und Argumente aus einer neuen Perspektive zu sehen. Wenn Vergleiche allerdings bewirken, dass eine Diskussion nicht mehr konstruktiv ist, ja sogar eine Barriere schaffen, zum Beispiel, indem vom ursprünglichen Problem abgelenkt oder gar die Moral infrage gestellt wird, nennt man dies Whataboutism.
Unter dem englischen Begriff Whataboutism, welcher in den letzten Jahren auch vermehrt im deutschen Sprachgebrauch verwendet wird (1), versteht man die Praxis, auf Kritik oder eine schwierige Frage mit einer ähnlichen Kritik oder einer anderen verwandten Frage zu reagieren, welche in der Regel mit "Was ist mit...?" beginnt (2,3). Konstruktive bzw. lösungsorientierte Diskussionen werden so bewusst oder unbewusst ausgebremst.
Vergleiche in Debatten sind zwar wichtig, werden aber vor allem dann zu Whataboutism, wenn damit einem Argument ausgewichen und so vom eigentlichen Thema abgelenkt wird. Diskussionen werden dadurch in der Regel unproduktiv und nicht mehr zielführend, weshalb Whataboutismus als eine destruktive Ablenkungs- bzw. Hinhaltetaktik gilt. Whataboutism ist auch eine verwandte Variante des Tu-quoque-Arguments, bei dem die Moral des Anderen und somit die Berechtigung zur Kritik infrage gestellt wird, während auf die Aussage nicht näher eingegangen wird. Ein gängiger Vorwurf beim Whataboutism ist dabei die Doppelmoral.
Lese-Tipp: Was bedeutet "Woke"? - Bedeutung und Herkunft erklärt
Den Mechanismus bzw. die Argumentationsstrategie von Whataboutism gab es sicherlich schon immer. Geprägt wurde der Begriff selbst laut Oxford-Lexico allerdings bereits in den 70er-Jahren, damals noch unter dem Synonym "whataboutery" (4). In den 90er-Jahren begann sich langsam der Begriff „whataboutism“ zu entwickeln. Den Begriff populär gemacht haben soll vor allem der Journalist Edward Lucas im Jahr 2008 in einem Artikel des Economist (5), indem er Whataboutism als Propaganda-Taktik Russlands beschrieb und den Gebrauch der letzten Jahre für ein Zeichen der Wiederkehr des kalten Krieges hielt. Whataboutisim findet heute regelmäßig Verwendung in Bereichen der politischen Rhetorik, aktuell verstärkt im Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine (6). Kritisch werden die Mechanismen des Whataboutism vor allem wegen der Gefahr der Verstärkung einer gesellschaftlichen Spaltung gesehen (7).
Whataboutism findet sich sowohl in politischen Debatten, den Sozialen Medien, aber auch in persönlichen Gesprächen wieder. Das Muster folgt dabei grob zwei Schritten. Die moralische Berechtigung für das Aufstellen der Behauptung wird durch die Gegenfrage vermeintlich annulliert (Schritt 1), wodurch die Behauptung indirekt als falsch oder zumindest als unangebracht dargestellt wird (Schritt 2) und nicht mehr in der Diskussion verwendet werden soll. Whataboutism in Gesprächen lässt sich durch die folgenden Punkte leicht erkennen:
- Die Gegenfrage bzw. das Gegenargument hat nur noch wenig mit dem Ursprungsargument zu tun.
- Es fällt schwer, auf das Ursprungsproblem zurückzukommen, da wiederholt durch Gegenfragen ausgewichen wird.
- Wenn sich die Person in einer Abwehrhaltung befindet, kann es auch passieren, dass die Gegenfrage emotionaler formuliert ist.
Wichtig: Nicht jede Abweichung vom Thema ist auf eine Stufe mit Whataboutism zu stellen. Konstruktive Abweichungen helfen, Themen in Relation zu setzen und sollten deswegen unbedingt von Whataboutism unterschieden werden. Markiert man wichtige Argument des Gegenübers mit "Whataboutism", blockiert man selbst eine konstruktive Diskussion, indem diese nur einseitig betrachtet wird.
Lese-Tipp: Was bedeutet "Stonewalling"? - Bedeutung und Herkunft erklärt
Whataboutism: Richtig reagieren
Whataboutism bremst Diskussionen aus und hemmt deren Fortschritt. Damit Gespräche sich dadurch nicht im Kreis drehen, ist es wichtig, entsprechend zu reagieren und den Fokus wieder zurück auf das entsprechende Ursprungsthema zu bringen. Wie man auf Whataboutism in Diskussionen reagiert, ist dabei in erster Linie abhängig von der Art des Gegenbeitrages und der Beziehung zur anderen Person. Unterscheiden sollte man dabei:
Wenn ein Gegenargument im Kern stimmt, aber dennoch das Vorankommen des Gesprächs ausbremst, sollten Sie Verständnis und Zustimmung äußern, aber mitteilen, dass Sie gerne wieder zum ursprünglichen Thema zurückkehren möchten. Sie können auch vorschlagen, im Anschluss über das neue Thema weiterzusprechen.
Ein Grundzug des Whataboutism ist es, dass der Gesprächspartner aus der Fassung gebracht werden soll. Das ist vor allem dann der Fall, wenn der vermeintliche Vergleich nicht beurteilt werden kann. In diesem Fall können Sie zum Beispiel antworten, dass Sie den Gegenbeitrag nicht beurteilen können und gerne wieder über das ursprüngliche Thema reden möchten. Auch hier können Sie vorschlagen, dass Sie den Gegeneinwand im Anschluss zusammen unabhängig überprüfen und dann darüber weiterreden.
Wenn das Gegenargument schlicht falsch ist, sollten Sie das am besten (wenn möglich auch mit Daten oder einer Quelle belegt) mitteilen und anschließend darum bitten, wieder über das Ursprungsthema weiter zu reden. Hierbei kann es allerdings besonders schnell passieren, dass das Ursprungsthema nicht mehr aufgegriffen und stattdessen über den Wahrheitsgehalt des neuen Themas diskutiert wird.
Richtig reagieren bzw. kontern
Themenfremde Gegenargumente sind oft Scheinargumente, die für eine konkrete Diskussion wertlos sind. Die folgenden Tipps helfen beim Kontern bei Whataboutism:
Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine Diskussion entgleitet und es schwerfällt, bei einem Thema zu bleiben, können Sie im Gespräch auch die Frage stellen, worum es eigentlich geht bzw. was der Kern der Diskussion ist. So können Sie sich mit Ihrem Gesprächspartner zusammen wieder auf das Ursprungsthema bzw. eine Gesprächsstruktur einigen. Ein Thema nach dem anderen.
Durch Verständnis für die Gegenfragen und Einwände zeigen Sie Mitgefühl und Wertschätzung, wodurch die Diskussion besser auf der Sachebene geführt werden kann und ein emotionales Wechselspiel besser außen vor bleiben kann.
Sein Sie ruhig und rational, so bleibt auch das Gespräch eher konstruktiv. Wer Whataboutism nutzt, dem fehlen schlicht die Argumente und möchte sich dies nicht eingestehen.
Wenn der Gegenüber emotional in ein Thema investiert und die Beziehung zu ihm/ihr eng ist, sollte das Verhältnis durch die Diskusion nicht belastet werden. Dann kann es Sinn machen, das Gespräch langsam auszuschleichen und später bei einem passenderen Moment neu und von einer anderen Richtung aufzugreifen.
Whataboutism und Strohmann-Argumente
Eng verwandt mit Whataboutism sind sogenannte Strohmann-Argumente. Während beim Whataboutism in erster Linie mit Gegenfragen reagiert wird, welche die Diskussion vom Argument wegleiten, wird beim Strohmann-Argument ein Argument scheinbar aufgegriffen, da es stark verzerrt wird. Das ursprüngliche Argument wird so zu einem Strohmann, der sich nicht mehr wehren kann. Ein erster Hinweis ist, wenn man in einem Gespräch das Gefühl hat: "Das habe ich so nicht behauptet." Argumentiert zum Beispiel Person A für mehr Kameras an Bahnhöfen, um Verbrechen besser aufzuklären und Person B sagt, dass Person A einen Überwachungsstaat will, wurde aus dem Argument ein Strohmann gemacht. Dann sollte klargestellt werden, dass es sich um einen falschen Rückschluss handelt.



