Die enormen Erwartungen blieben 1848/49 unerfüllt
Der Historiker Gerhard Fritz erläutert wenig bekannte Hintergründe und wichtige Abläufe der demokratischen Revolution in der Mitte des 19. Jahrhunderts sowie die Rolle des Murrhardter Schlossermeisters Ferdinand Nägele als Abgeordneter der Nationalversammlung in einem von der Stadt Murrhardt veranstalteten Vortrag.
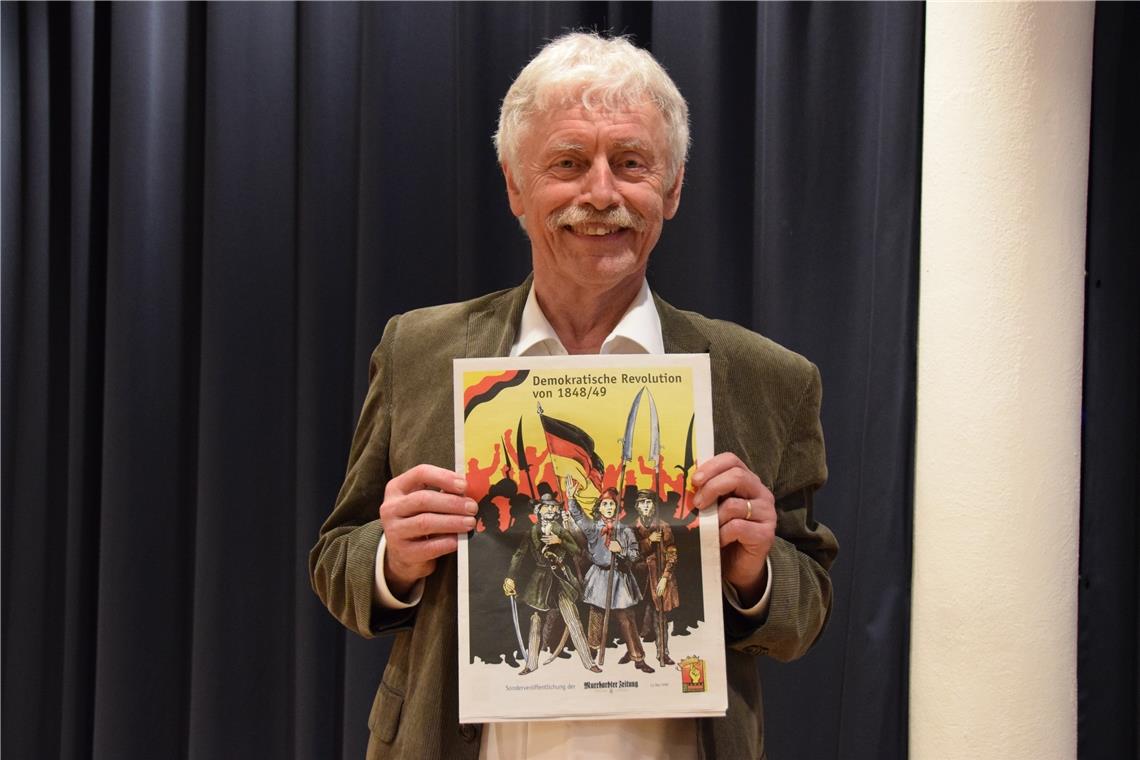
Gerhard Fritz mit der Beilage der Murrhardter Zeitung von 1998. Foto: Elisabeth Klaper
Von Elisabeth Klaper
Murrhardt. Entscheidende Ereignisse und teils kaum bekannte Ursachen für das Scheitern der demokratischen Revolution 1848/49 verdeutlicht ein Vortrag von Professor Gerhard Fritz. Ebenso die Bedeutung des Murrhardter Schlossermeisters Ferdinand Nägele (1808 bis 1879), Abgeordneter unserer Region der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche.
Die Revolution ging von Frankreich aus: Im Frühjahr 1848 kam es in den 35 Staaten des Deutschen Bunds zu Aufständen und blutigen Barrikadenkämpfen in den Machtzentren Berlin (Preußen) und Wien (Österreich). Ziele waren ein einheitlicher demokratischer deutscher Staat aller deutschsprachigen Gebiete, Pressefreiheit, ein frei gewähltes Parlament, Volksbewaffnung und diverse Rechte auf Kommunalebene. Bei den ersten freien demokratischen Wahlen der Abgeordneten zur Nationalversammlung waren alle Männer ab 25 Jahren wahlberechtigt, unabhängig vom Einkommen.
Nach intensivem Wahlkampf gewann Ferdinand Nägele im Wahlkreis aus den Oberämtern Backnang und Weinsberg. Er war einer von nur vier Handwerkern im von Akademikern dominierten „Professorenparlament“. Die Erwartungen und die Begeisterung waren ungeheuer: „Die Bevölkerung erhoffte das Ende der Kleinstaaterei und ein freies, geeintes Deutschland.“ Als Nägele abreiste, feierte man ihn in Gedichten, Bürger standen Spalier und der Einzug der Parlamentarier in die Frankfurter Paulskirche als größtem geeignetem Raum war ein „ungeheures Erlebnis“ für eine riesige Menschenmasse, erzählt Fritz.
Es gab noch keine Parteien, doch rasch bildeten sich politische Fraktionen, die sich in Gaststätten versammelten. „Nägele war ein ausgesprochener Linker“ und traf sich mit Gleichgesinnten im Deutschen Hof, die einen großdeutschen Staat mit Gebieten Österreichs wünschten, die zum Deutschen Bund gehörten. Die Konservativen erstrebten dagegen einen kleindeutschen Staat unter preußischer Führung. „Fast jeden Abend schrieb der 40-jährige Nägele Berichte über die Arbeit der Nationalversammlung für den Murrtalboten und andere württembergische Zeitungen“, so der Historiker.
Sie wählte eine provisorische Regierung und fand einen „Reichsverweser“ (Verwalter) im „volksnahen“ Erzherzog Johann von Habsburg, der aus Liebe eine nicht standesgemäße Postmeistertochter geheiratet hatte. Erste Aufgabe war die Ausarbeitung einer Reichsverfassung, „dann ergibt sich alles Weitere“ wie Steuereinnahmen und eigene Streitkräfte. „Diese Verfassung weist erhebliche Parallelen zum Grundgesetz auf“, da sich die Politiker 1949 daran orientierten. Im Frühjahr 1849 war das Werk fertig: 28 Staaten unterschrieben, auch Württemberg, elf aber nicht, darunter die größten wie Preußen und Österreich.
„Preußen wollte Österreich nicht dabeihaben“ und für Österreich gab es nur eine Lösung mit allen Ländern des Vielvölkerstaats. Deren Einwohner wollten aber keine Deutschen sein, darum zog die Donaumonarchie ihre Abgeordneten ab. Entscheidend dafür, „dass die Revolution ins Schleudern kam“, waren laut Fritz jedoch außerdeutsche Faktoren. Im Zentrum stand der Konflikt mit dem Königreich Dänemark um das Herzogtum Schleswig mit mehrheitlich deutscher Bevölkerung, das weder zum Deutschen Bund noch zu Dänemark gehörte. Der nationalistische dänische König, der als Herzog über Schleswig und Holstein herrschte, wollte Schleswig einnehmen, worauf die deutschen Schleswiger die Nationalversammlung um Hilfe baten. „Auch Nägele war überzeugt, dass Schleswig zu Deutschland gehört“, doch da das Parlament keine Armee hatte, bat es Preußen und Österreich um militärische Unterstützung, deren Truppen die Dänen an Land erfolgreich zurückdrängten. Doch die dänische Marine blockierte die deutschen Häfen, wogegen die Deutschen ohne Seestreitkräfte machtlos waren.
Die Folge waren lebhafte Diskussionen und die Forderung, eine „Reichsflotte“ aufzustellen, auch von Nägele und im Murrtalboten. Doch da mischten sich die Großmächte Großbritannien und Russland ein, die wie Frankreich keinen vereinigten deutschen Staat wollten. Ultimativ forderten sie einen Waffenstillstand, den die unter Druck gesetzte Nationalversammlung abschloss. Der Unmut über diesen „nationalen Verrat“ führte im September 1848 zum spontanen Aufstand in Frankfurt, bei dem Radikale zwei Konservative ermordeten.
Dies war der Anfang vom Ende der Revolution: Überall schlugen die Truppen Aufstände nieder, Preußens König Friedrich Wilhelm IV. lehnte im April 1849 die ihm angetragene Kaiserkrone ab. Die preußischen Abgeordneten verließen die Nationalversammlung, das „Rumpfparlament“ aus noch 130 Mitgliedern, darunter auch Nägele, zog nach Stuttgart. Im Juni 1849 folgte dann dessen Zwangsauflösung, da Preußen Württemberg mit Einmarsch drohte, und im Juli kapitulierten badische vor preußischen Truppen nach einem regelrechten Krieg.
Fazit: „Die Revolution 1848/49 scheiterte, weil die europäischen Großmächte keinerlei Interesse an einem einheitlichen deutschen Staat hatten und die Nationalversammlung keine reale Macht besaß“, so Gerhard Fritz vor zahlreichen Zuhörern im Heinrich-von-Zügel-Saal.
Info Die Stadt Murrhardt reproduziert die 1998 veröffentlichte Beilage „Demokratische Revolution 1848/49“ der Murrhardter Zeitung als Broschüre. Interessierte können sie kostenlos beim Kulturamt bestellen unter Telefon 07192/213-222 oder per E-Mail an kultur@murrhardt.de.


