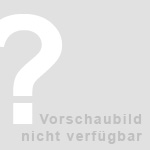Macht, Erziehung und Respekt
Natürliche Autorität – und wie man sie erlangt
Sich gegenüber Kindern durchzusetzen ist für Eltern in der Regel kein Problem – sind sie doch meist noch stärker und haben wichtige Ressourcen wie Geld. Natürliche Autorität aber funktioniert ohne Angst und Drohen.

© Adobe Stock/gorynvd
Warum nehmen diese Jungs ihren Fußballtrainer als Autorität wahr?
Von Sandra Markert
Jeder kennt sie: die Eltern, Lehrpersonen, Fußballtrainer, Erzieherinnen, die viel brüllen und bestrafen, um sich bei Kindern Respekt zu verschaffen. Es gibt aber auch Eltern, Lehrpersonen, Fußballtrainer, Erzieherinnen, die müssen scheinbar gar nichts tun, um respektiert zu werden. „Der oder die hat so eine natürliche Autorität“ heißt es dann gern. Aber was ist eigentlich damit gemeint? Und lässt sich das lernen?
„Autorität kann ich nur ausüben, wenn jemand anderer mir Autorität gewährt. Ein Grund das zu tun ist, darauf zu vertrauen, dass die Autorität mir in bestimmter Hinsicht überlegen ist“, sagt der Erziehungswissenschaftler Thorsten Merl von der Universität Koblenz. Gegenüber Kindern seien Erwachsene grundsätzlich Autoritätspersonen, weil kein Kind selbstständig und selbstbestimmt auf die Welt kommt.
Kinder wollen immer mehr mitbestimmen
Also entscheiden die Eltern, wie das Kind heißt, was es anzieht, wann und was es zu essen bekommt, wann sie dem Kind die Möglichkeit geben, zu schlafen, wann sie es in welchem Kindergarten anmelden. Mit den Jahren können und wollen Kinder immer mehr selbst bestimmen und entscheiden – nur ist es nicht immer das, was sich Eltern, Erzieherinnen oder Lehrpersonen so vorstellen.
Dass die Erwachsenen sich dennoch weiterhin durchsetzen, wann immer sie dies wollen oder für richtig halten, liegt an ihrer nach wie vor machtvolleren Position. „Diese haben sie durch ihren Zugang zu Ressourcen wie Geld und durch mehr Lebenserfahrung inne“, sagt die Pädagogin und Familienbegleiterin Susanne Mierau. Die entscheidende Frage sei, wie Erwachsene mit dieser Macht umgingen.
Autoritäres Verhalten ist bequem
„Der bequemste Weg ist autoritäres Verhalten“, sagt die Psychologin Marion Lemper-Pychlau. Wer den Zugang zu Ressourcen hat, kann diesen auch verweigern – oder zumindest damit drohen, dies zu tun („Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, streiche ich dir das Taschengeld.“ – „Wenn du den Salat nicht isst, gibt es keinen Nachtisch.“). Wer größer, stärker, lauter ist, kann Kinder durch kommunikative oder körperliche Gewalt in ihre Schranken verweisen. „Diese Art der Autorität basiert rein auf Angst und Abhängigkeit des anderen“, sagt Marion Lemper-Pychlau.
Langfristig habe autoritäres Verhalten deshalb zur Folge, dass man das Vertrauen der Kinder verliere und die Beziehung schädige. Wie Kinder damit umgehen, sei ganz unterschiedlich. Manche, erzählt, Marion Lemper-Pychlau, passen sich anstandslos an alles an und zeigen keinerlei Eigeninitiative mehr.
Andere kämpfen stark gegen ihre Eltern an, gerade während der Pubertät. Wieder andere reden kaum mehr mit Erwachsenen, flüchten zu Freunden oder in fiktive Computerspielwelten. „Letztlich verschaffe ich mir durch autoritäres Verhalten nicht mehr Respekt, sondern verliere vielmehr an Autorität“, sagt Marion Lemper-Pychlau.
Vorübergehende Autorität
Kinder nun einfach machen zu lassen, sie von Anfang an möglichst nur eigenständig entscheiden zu lassen wie das die antiautoritäre Erziehung eine Weile lang propagiert hat, funktioniert aber auch nicht – eben weil Kinder Schutz und auch Führung durch starke, sichere Bezugspersonen brauchen, bis sie selbst in der Welt zurechtkommen. „Unser ganzes Erziehungs- und Bildungssystem basiert darauf, dass ein Autoritätsverhältnis dafür zumindest vorübergehend notwendig ist“, sagt Thorsten Merl.
Damit dieses Autoritätsverhältnis nun nicht in eine unhinterfragte Gefolgschaft oder einen Machtmissbrauch mündet, sollte die Autoritätsperson mit einigen Kompetenzen aufwarten. „Damit strahlt man dann etwas aus, dass andere einem vertrauen und einen ernst nehmen, ohne dass man Angst erzeugen muss“, sagt Marion Lemper-Pychlau. Für eine solche natürliche Autorität braucht es Lemper-Pychlau zufolge drei Dinge: Sachkompetenz, Beziehungskompetenz und Persönlichkeitskompetenz.
Wenn Kindergartenkinder einen Wutanfall bekommen, weil sie länger auf dem Spielplatz bleiben wollen, oder Teenager mit Türen knallen statt aufzuräumen, können Eltern das persönlich nehmen. „Wer ein bisschen Ahnung von Entwicklungspsychologie hat, weiß aber, dass die Kinder das nicht machen, um ihre Eltern zu ärgern“, sagt Marion Lemper-Pychlau. Eltern, die verstehen wollen und verstehen können, warum sich ein Kind verhält, wie es sich verhält, reagieren in solchen Situationen weniger hilflos. „Eltern, die sich selbst machtlos und unsicher fühlen, laufen am stärksten Gefahr, Macht auszuüben und ihre Vorstellungen, Denkweisen, Bedürfnisse und Wünsche über die der Kinder zu stellen“, sagt Susanne Mierau.
Augenhöhe mit Plan
Bei der Beziehungskompetenz geht es darum, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen etwas zuzutrauen, sich aber auch mal in ihre Lage hineinversetzen zu können und sie als Person grundsätzlich immer wertzuschätzen, auch dann, wenn einem bestimmte Verhaltensweisen vielleicht nicht gefallen. „Das hat auch viel mit kommunikativen Fähigkeiten zu tun, ob ich sage: du hast mich geärgert. Oder es hat mich geärgert, dass du die Spülmaschine nicht ausgeräumt hast“, sagt Marion Lemper-Pychlau.
Voraussetzung für eine solche Beziehung ist allerdings, dass Eltern selbst einen Plan vom Leben haben, selbstbewusst und mit einem gesunden Selbstwertgefühl die Verantwortung für sich und ihr Kind übernehmen – und dabei auch eine gewisse Zuversicht ausstrahlen. „In diesem Bereich der so genannten Persönlichkeitskompetenz aber haben ganz viele Erwachsene Defizite“, sagt Marion Lemper-Pychlau.
An die Zukunft denken
Wer sich mehr natürliche Autorität wünscht, tut ihr zufolge deshalb gut daran, zunächst an sich selbst zu arbeiten. „Ich muss mich beobachten, meinen Umgang mit den Kindern. Wie verhalte ich mich, wie verhalten sie sich – und ist diese Reaktion das, was ich möchte“, sagt Marion Lemper-Pychlau. Mit älteren Kindern lohnt es sich auch immer wieder das Gespräch darüber zu suchen, wie Situationen künftig anders gelöst werden können. „Das ist definitiv eine ganze Menge Arbeit, man muss jahrelang sehr viel investieren und auch sehr viel mehr als wenn man sich einfach nur autoritär verhält“, sagt Marion Lemper-Pychlau.
Warum sich diese Mühe dennoch lohnt? Weil Eltern irgendwann ihre machtvollere Position gegenüber den Kindern verlieren. „Die elterliche Autorität ist ja paradoxerweise und zugleich erfreulicherweise dazu da, die Kinder später in die Lage zu versetzen, ohne diese Autorität auszukommen“, sagt Thorsten Merl. Dann können sie sich aus freien Stücken entscheiden, ob sie den Rat der Eltern und die Beziehung zu ihnen brauchen – oder eben nicht.
Info
Strafe oder Konsequenz Drohen und Bestrafen halten die meisten Eltern in der Erziehung heute nicht mehr für richtig. Sätze wie „Wenn du dich jetzt nicht anziehst, dann gehe ich ohne dich“, fallen dennoch regelmäßig. „Sobald das Ziel ist, dem Kind Angst einzujagen, ihm eine Art Schmerz zuzufügen, damit es lernt, sich beim nächsten Mal richtig zu verhalten, sind Konsequenzen nur ein neues Wort für Strafe“, sagt Maya Risch, Familienberaterin aus Zürich. Der Unterschied zwischen Strafe und eine natürliche Konsequenz eines Verhaltens aufzeigen – was in der Erziehung durchaus wichtig ist – ist oft ein sehr feiner und hat vor allem mit Kommunikation und Haltung zu tun. Damit Kinder aus einer Situation etwas lernen können, müssen sie begreifen, worum es den Eltern geht– im Beispiel etwa darum, selbst nicht zu spät zur Arbeit zu kommen. (mar)