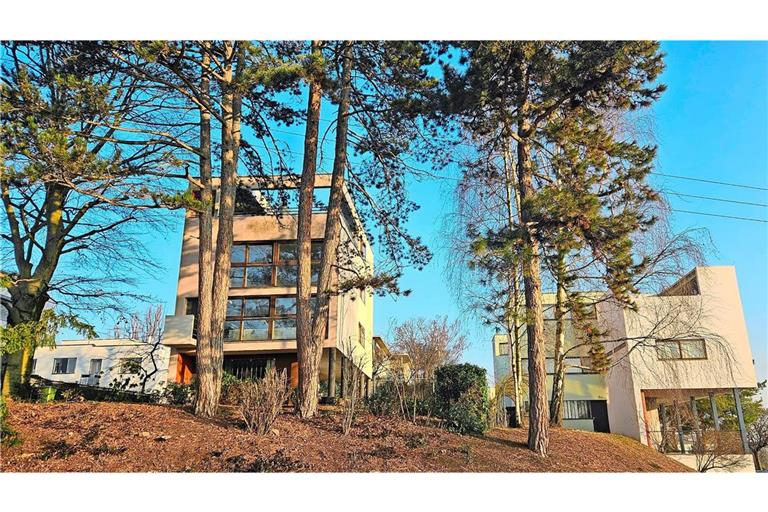Bernius dirigiert Mozarts Requiem
Tod und Erklärung
Frieder Bernius dirigiert Mozarts Requiem und die Symphonie Funèbre von Joseph Martin Kraus in der Stuttgarter Markuskirche. Er intensiviert in der Musik den Ausdruck von Trauer, Angst und Zuversicht, statt ihn in einer Hülle des Wohlklangs zu verharmlosen.

© Roberto Comuzzo
Originalklang-Dirigent Frieder Bernius hat in der Stuttgarter Markuskirche Mozarts Requiem entharmlost.
Von Martin Mezger
Wie der Tod klingt? Vielleicht wie diese stockende c-Moll-Umlaufbahn, in der gedämpfte Paukenschläge, rast- und ratlose Synkopen die Sprachlosigkeit der Trauer umkreisen, in diesem Fall um den ermordeten schwedische König. Bald schimmert zwar milde As-Dur-Verklärung in Joseph Martin Kraus’ Symphonie Funèbre. Aber Erlösung vom Tod klingt anders. Vielleicht so: Zum hohen B wirbelnde Koloraturen kontrapunktieren ein Motiv, das für Kreuz und Todespein steht. Das musikalische Kruzifix, das Mozart ins Kyrie-Thema seines unvollendeten Requiems nagelte, hat er von Händels „Messias“ abgenommen, wo dieselbe Vierton-Kreuzung das Leiden des Erlösers bezeichnet: ein fixes Kreuzmotiv, Klangsymbol des christlichen Glaubenskerns.
Kreuz und Gloria: Wenn ein Requiem das am Anfang verkündet, darf es auch am Ende mit denselben Tönen ins ewige Licht jubeln – ob nun der sterbende Mozart, sein viel gescholtener Requiem-Vervollständiger Süßmayr oder der Heilige Geist die Idee hatte. Die Reprise ist tieferer Sinn, kein Notbehelf.
Ein Chorklang wie das ewige Licht
In der Stuttgarter Markuskirche lässt Frieder Bernius das ewige Licht seines phänomenalen Kammerchors leuchten: schlackenlos und seraphisch rein, mit schönster Prägnanz in allen Stimmen und schier unendlicher Spannkraft vom substanziellen Piano bis zum runden, unverkrampften Forte. Freilich droht dem himmelstürmenden Jubel nach wie vor die tragische d-Moll-Fallhöhe. Der Tod bleibt eine ernste Angelegenheit. Bernius hütet sich denn auch vor falscher Erbaulichkeit. So legt die Hofkapelle Stuttgart gleich zu Beginn mit ihren Streicher-Staccati kein letztes Ruhekissen unter die Holzbläser-Elegien, sondern unruhig Gespanntes. Und im Lacrymosa meiden die herb und intonatorisch riskant markierten Violinfiguren jede tränenselige Larmoyanz, betonen den Stachel des Todes. Umso überirdischer dann der Harmonie- und Farbwechsel bei den Worten „Pie Jesu.“
Bernius dirigiert eine Entharmlosung des Werks. Da wird nichts unmusikalisch gegen den Strich gebürstet, aber der sonst oft in einer Hülle des Wohlklangs erstickte Ausdruck von Trauer, Angst und Zuversicht intensiv erleuchtet. Zum Beispiel im Recordare-Quartett, wo die exzellenten Solisten Hannah Morrison (Sopran), Marie Henriette Reinhold (Alt), Florian Sievers (Tenor) und Felix Rathgeber (Bass) samt Orchester die wechselnden Empfindungen in Anschlag brachten, ohne den großen kompositorischen Bogen zu beschädigen. Die revidierte Fassung Franz Beyers schien Bernius für all das geeignet. Unter allen selbsternannten Requiem-Verbesserern ist Beyer der respektvollste. Er beschränkt sich auf Retuschen.
Letzte Dinge zwischen Stammeln und ewigen Worten
Bernius’ so sensibler wie analytischer Zugriff klärt mit der Subjektivität dieser Totenmesse auch ihre Objektivität im Netzwerk sakraler Klangsprache. Tod und Erklärung, sozusagen. In „Misericordias Domini“, einer vorangestellten kontrapunktischen Demo-Pièce des 19-jährigen Mozart, wandelt sich der deklamatorische Themenkopf kurz vor Schluss ebenfalls in ein Kreuzmotiv. Während Kraus’ beklemmende Symphonie erst in einem ganz anderen Zitat wieder zur Sprache findet, dem eines Chorals. Letzte Dinge, zwischen Stammeln und ewigen Worten.